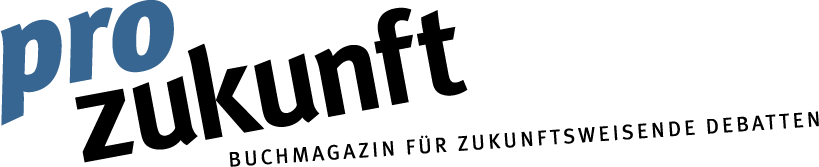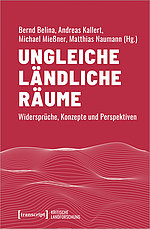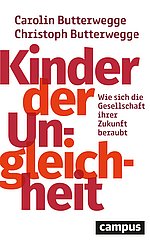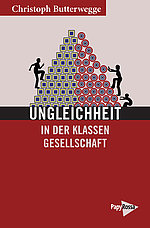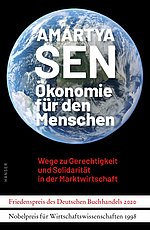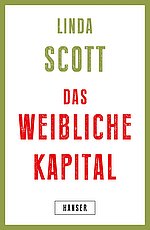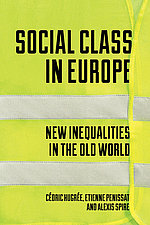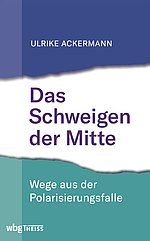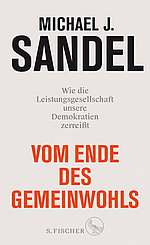
Was ist Leistung? Mit dieser Frage konfrontiert uns der US-Philosoph Michael J. Sandel und zeigt, dass die gegenwärtig geläufige Definition von dem, was als Leistung symbolisch wertgeschätzt und praktisch durch Löhne anerkannt wird, eine große Gruppe von Menschen ausgrenzt. Ihm zufolge liegt der Hauptgrund für das Erstarken des Populismus und gesellschaftlicher Spaltung nicht primär in der steigenden Ungleichheit, sondern in der fehlerhaften Bewertung von Leistung.
Gesellschaften spalten sich gefangen im meritokratischen Ideal selbst, so der Autor: Das Problem liege in der Überzeugung, dass sozialer Aufstieg durch Bildung garantiert sei, dass das Erreichen von akademischen Titeln ausschließlich auf Leistung basiere, dass weitere Faktoren keine Rolle spielten. Diese Einstellung führe zu einer trügerischen Gewinnermentalität bei all jenen, die es scheinbar „geschafft“ haben; im Umkehrschluss werde Misserfolg als Eigenverschulden gewertet.
Kritisch widmet sich Sandel im Kapitel „Ausleseapparat“ dem Bildungssystem, thematisiert etwa den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Universitäten von 2019, den er als repräsentativ für die Überheblichkeit einer Elitegruppe versteht, die zugleich einen enormen Druck eines Statuserhalts verspüre. Kritisch widmet er sich auch dem Politischen: Unabhängig von Parteizugehörigkeit überwiege das Credo, des eigenen Glückes Schmied zu sein, ein Denken, welches sich sowohl in politischen Reden wie auch im tagespolitischen Geschehen widerspiegele. Wichtig dabei: „Interpretiert man den populistischen Protest als entweder böswillig oder fehlgeleitet, entlässt man die herrschenden Eliten aus der Verantwortung dafür, dass sie die Bedingungen geschaffen haben, welche die Würde der Arbeit zersetzt und viele mit dem Gefühl zurückgelassen haben, nicht geachtet zu werden und machtlos zu sein.“ (S. 32)
Gekonnt gliedert Michael J. Sandel in diesem Buch populistische Bewegründe am Beispiel der USA auf, verweist hierfür aber natürlich auf gesellschaftliche Probleme, die nicht zuletzt auch Europa betreffen. Für ein gutes solidarisches Miteinander bräuchten wir, so der Autor, mitunter eine Kultur der Demut; die Anerkennung, dass Erfolg nicht nur auf eigene Leistung zurückzuführen sei, sondern auch auf glückliche Zufälle.