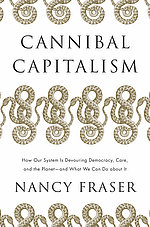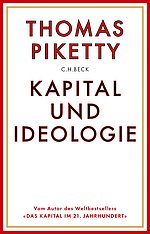
Thomas Piketty hat ein neues Buch vorgelegt. Es heißt Kapital und Ideologie und untersucht, wie Ungleichheiten in Vergangenheit und Gegenwart gerechtfertigt wurden und werden.
Pikettys Buch ist eine historische Darstellung. Der Autor verwendet sehr viel Zeit und Raum darauf, die soziale Ungleichheit in verschiedenen Perioden zu dokumentieren. Der Kern dabei ist aber stets, zu zeigen, mit welchen Argumenten, Erklärungen diese Ungleichheiten gerechtfertigt wurden.
Nehmen wir zum Beispiel die dreigliedrige Gesellschaft des Mittelalters. In ihrer einfachsten Form setzte sich diese aus drei unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammen. Klerus, Adel und Ritterstand hatten klare Funktionen. Der Auftrag des Klerus war die geistliche Gemeinschaft, er kümmerte sich um Bildung und darum, dem Leben Sinn zu geben. Der Adel sorgte für Sicherheit, Schutz und Stabilität. Der dritte Stand waren die arbeitenden Klassen.
Die dreigliedrigen Gesellschaften verkörpern für Piketty nicht einfach eine an sich ungerechte, despotische Ordnung. „Das Bedürfnis nach Sicherheit und Sinn ist für alle Gesellschaften elementar. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für die weniger entwickelte Gesellschaften, welche durch territoriale Zerstückelung und schwache Kommunikationswege gekennzeichnet sind, durch chronische existenzielle Instabilität und Unsicherheit, deren Fundamente von Plünderei, mörderischen Überfälle oder Epidemien bedroht sein können. Sobald religiöse und militärische Gruppen mit jeweils an Zeit und
Ort angepassten Institutionen und Ideologien glaubhaft auf diese Sinn- und Stabilitätsbedürfnisse eingehen können, wobei die Ersteren eine große Erzählung von den Ursprüngen und der Entwicklung der Gemeinschaft anbieten, konkrete Zeichen, mit denen man seine Zugehörigkeit ausdrücken und die Fortdauer garantieren kann, und die Zweiteren eine Ordnung bieten, die die Grenzen der rechtmäßigen Gewalt abstecken und die Sicherheit von Personen und Gütern gewährleisten, ist es wenig erstaunlich, dass die trifunktionale Ordnung der betroffenen Bevölkerung legitim erscheinen kann.“ (S. 90)
Die extreme Ungleichheit der Sklaverei bedurfte auch des Arguments. Führende Stimmen, die sich für Sklaverei aussprachen, stellten diese als positives Gut, nicht als Übel dar: Alte und Kranke würden auf den Plantagen des Südens deutlich besser behandelt als in den städtischen Industrienationen des Nordens, Großbritanniens und Europas, wo erwerbsunfähige Personen auf der Straße oder in inhumanen Armenhäusern landeten. Auf Plantagen würden sie Teil der Gemeinschaft bleiben und bis in ihre letzten Tage Respekt und Würde erfahren, was woanders nicht gewährleistet wäre. Plantagenbesitzerinnen und -besitzer würden selbst dem Ideal des agrarischen Republikanismus und der lokalen Gemeinschaft entsprechen (vgl. S. 307).
Eigentumsrechte und Ungleichheit
Auch Ungleichheit in der später entstehenden Eigentümergesellschaft habe ihre Erklärung und Zustimmung gefunden. Wenn man die in der Vergangenheit erworbenen Eigentumsrechte und ihre Ungleichheit zu hinterfragen beginnt, und dies im Sinne eines respektablen Begriffs von sozialer Gerechtigkeit, der unausweichlich immer unvollkommen definiert und akzeptiert wird, nie einen völligen Konsens hervorbringen wird, riskiert man dann nicht, dass unklar bleibt, wann dieser gefährliche Prozess zu stoppen wäre? Riskiert man nicht, geradewegs auf politische Instabilität und dauerhaftes Chaos zuzusteuern, was letztendlich größeren Schaden bedeutet? (vgl. S. 167)
„In den heutigen Gesellschaften übernimmt diese Rolle vor allem die proprietaristische und meritokratische, den Unternehmergeist beschwörende Erzählung: Die moderne Ungleichheit ist gerecht und angemessen, da sie sich aus einem frei gewählten Verfahren ergibt, in dem jeder nicht nur die gleichen Chancen des Marktzugangs und Eigentumserwerbs hat, sondern überdies ohne sein Zutun von dem Wohlstand profitiert, den die Reichsten akkumulieren, die folglich unternehmerischer, verdienstvoller, nützlicher als die anderen sind.“ (S. 13)
Piketty bringt die Abfolge dieser Debatten, die hier nur bruchstückhaft wiedergegeben werden können, in einen logischen Zusammenhang und er meint zu wissen, was diese Erzählungen von Form zu Form vorangetrieben habe. Es sei der Kampf für Gleichheit und Bildung gewesen, der die Wirtschaftsentwicklung und den menschlichen Fortschritt möglich gemacht habe. Nicht die Heiligsprechung von Eigentum, Stabilität und Ungleichheit.
Zunehmende Ungleichheit durch die Entwicklung des Steuersystems
Piketty widmet sich ausführlich der jüngeren Entwicklung. Zwischen 1980 und 2008 sei der Anteil am globalen Einkommenszuwachs, den sich die reichsten ein Prozent der Welt gesichert haben, bei 27 Prozent gelegen, gegenüber 13 Prozent für die Ärmsten 50 Prozent. Damit greift er die Studien seines vorhergehenden Werkes auf. Den Hauptgrund für die Entwicklung in Richtung zunehmender Ungleichheit sieht Piketty in der Entwicklung des Steuersystems gegeben. Er zeichnet detailliert nach, wie der Spitzensatz der Einkommenssteuer seit den 1970er Jahren in den meisten Staaten gesunken ist. Kritisch geht er dabei mit den Parteien der Arbeiterbewegung ins Gericht. Diese hätten sich zu Organisationen der Bildungsschichten entwickelt. Die Interessen der Arbeitenden seien so geschwächt worden.
Piketty ist davon überzeugt, dass zu Gunsten von Gleichheit ein Zusammenwirken verschiedener gesellschaftlicher Kräfte nötig ist. Gruppen unterschiedlicher Provenienz seien davon zu überzeugen, dass das, was sie miteinander verbinde, wichtiger sei als das, was sie voneinander trenne (vgl. S. 1177). Piketty: „Gerecht
ist eine Gesellschaft, die allen, die ihr angehören, möglichst umfänglichen Zugang zu grundlegenden Gütern gewährt. Zu solchen Grundgütern zählen namentlich Bildung, Gesundheit, aber auch das Wahlrecht und, allgemeiner gesprochen, Partizipation, also Mitbestimmung und möglichst umfassende Teilhabe aller an den verschiedenen Formen gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, staatsbürgerlichen, politischen Lebens.“ (S. 1187)