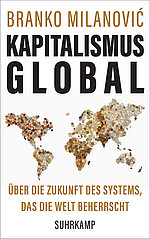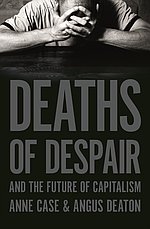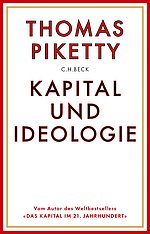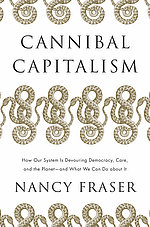
Nancy Frasers „Cannibal Capitalism. How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet – and What We Can Do about It“ folgt im Kern dem autokannibalistischen Bild des Ouroboros, einer Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Es zerlegt in vier dicht argumentierten Kapiteln, wie Kapitalismus, vielmehr gesellschaftliche Ordnung als bloßes Wirtschaftssystem, die „außerwirtschaftlichen“ Bedingungen seiner eigenen Existenz verschlingt. Die Ausbeutung der Arbeiter:innen wird erst durch Formen von fortlaufender Enteignung in vier zentralen Bereichen ermöglicht.
Vier zentrale Bereiche von Ausbeutung
Erstens: Race und Enteignung „along the global color line“. Die Arbeitsleistung von rassifizierten Bevölkerungsgruppen in „core“ und „periphery“, also im Globalen Norden (man denke an die Arbeit in Verteilerzentren von transnationalen Versandhandelskonzernen) wie im Globalen Süden, wurde und wird gar nicht oder nur unzureichend entlohnt. Erst durch die Enteignung der Arbeitsleistung von politisch vulnerablen Schwarzen Menschen und People of Color (die „Anderen“, unfrei, abhängig) wird die Ausbeutung weißer Arbeiter:innen (Individuen mit Rechten, Bürger:innen) profitabel.
Zweitens: Gender & Care. Der geschlechtersegregiert organisierte Kapitalismus trennt die Sphäre der wirtschaftlichen Produktion (männlich) von der der gesellschaftlichen Reproduktion (weiblich). Damit ist letztere, die zur Erhaltung des Systems notwendige Sorge-Arbeit, vor allem eines: Frauenarbeit. Sie wird abgewertet, bleibt un- oder unterbezahlt und wird – verstrickt mit Vorstellungen romantischer Liebe – als selbstverständlich zu leistender Liebesdienst dargestellt. Die Institutionen des Sozialstaats, die Reproduktionsarbeit leisten, wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend ausgehöhlt, und so führt der Zugang zum Arbeitsmarkt für die einen (privilegierte weiße Frauen) zur Enteignung der anderen (migrantische, Schwarze Frauen und Women of Color): in den „global care chains“ werden Fürsorge und gesellschaftliche Reproduktion immer an die nächstschwächere Gruppe weitergegeben, kommodifiziert oder privatisiert.
Drittens: Natur. Das Kapital hat eine kannibalistisch-extraktive Beziehung zur Natur; sie wird zur verdinglichten Ware gemacht und von den Besitzer:innen der Produktionsmittel als unerschöpfliche Ressource und endlose Mülldeponie betrachtet, ohne dabei die Abhängigkeit von endlichen, fossilen Rohstoffen und die Funktionsweise fragiler Kreisläufe zu bedenken. Statt oberflächlichem ökopolitischem Konsens (der auch von Rechten für Ökonationalismen instrumentalisiert werden kann) brauche es die Ausbildung gegenhegemonialer Positionen und einen Anti-Kapitalismus als „trans-environmental common sense“, also systemverändernde Nachhaltigkeitsbestrebungen verschränkt mit Fragen von sozialer Reproduktion, rassifizierter/imperialer Enteignung und demokratischer Partizipation.
Viertens: Public Powers. Um die konstitutiven Normen des Kapitalismus festzulegen und durchzusetzen, verlässt sich das System auf die Verteidigung von Privateigentum, Kapitalakkumulation und die Unterdrückung von Aufständen durch bestehende politische Kräfte, meist Nationalstaaten und ihre Exekutive. Unser oft konstatiertes „Demokratiedefizit“ führt Fraser nicht nur auf politische, sondern spezifisch kapitalistische Verhältnisse zurück: exzessive Schuldenpolitik und die Beschneidung der Handlungsfähigkeit von Staaten in Sachen Marktregulierung.
Eine beeindruckende Analyse
Fraser argumentiert mit Bezugnahme auf die vier historischen Phasen des Kapitalismus: vom Merkantilismus des 16. bis 18. Jahrhunderts hin zum Finanzkapitalismus der Gegenwart. Um die Klimakatastrophe zu verhindern und Ungleichheit zu beenden, reicht es laut Fraser nicht aus, die Phase des gegenwärtigen progressiven Neoliberalismus und Schuldenkapitalismus zu beenden, Kapitalismus als solcher müsse überwunden werden. In einer Zeit der Mehrfachkrisen, in der immer mehr Menschen ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr decken können und auf dem Enteignungs-Ausbeutungs-Spektrum immer weiter in Richtung Prekarität rutschen, stünden die Chancen für eine Allianz aller progressiven Kräfte – einer Bewegung aus Anti-Rassist:innen, Feminist:innen, Klimaschützer:innen und Demokratie-Aktivist:innen – nicht schlecht. Ein neuer, breit verstandener Sozialismus also. Das im Untertitel versprochene „What We Can Do About It“, warum Individuen in einer Zeit zunehmender Krisen nicht den Weg des Rechtspopulismus/Faschismus, den Weg des eigenen Vorteils über die transnationale Solidarität wählen würden, bleibt jedoch mit einem „weil sie es eben schaffen müssen“ und Gedanken zu „von Märkten losgelöster Grundversorgung für alle“ eher vage und explorativ. Fraser legt eine beeindruckend konzise Analyse unseres kapitalistischen Systems vor, den Weg zum von ihr skizzierten Sozialismus müssen ihre Leser:innen aber selbst finden.