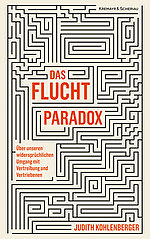Richard, ein pensionierter Professor für alte Sprachen, langweilt sich in seinem Ruhestand. Durch Protestaktionen afrikanischer Flüchtlinge auf dem Oranienplatz in Berlin wird er aufmerksam und beginnt sich für deren Schicksale zu interessieren. Er möchte erforschen, was die Flüchtlinge denken, zugleich aber, was ihn selbst beschäftigt, was beispielsweise Zeit bedeutet, die er nun im Überfluss hat. Und er denkt sich: „Über das sprechen, was Zeit eigentlich ist, kann er wahrscheinlich am besten mit denen, die aus ihr hinausgefallen sind.“ (S. 51)
Richard, ein pensionierter Professor für alte Sprachen, langweilt sich in seinem Ruhestand. Durch Protestaktionen afrikanischer Flüchtlinge auf dem Oranienplatz in Berlin wird er aufmerksam und beginnt sich für deren Schicksale zu interessieren. Er möchte erforschen, was die Flüchtlinge denken, zugleich aber, was ihn selbst beschäftigt, was beispielsweise Zeit bedeutet, die er nun im Überfluss hat. Und er denkt sich: „Über das sprechen, was Zeit eigentlich ist, kann er wahrscheinlich am besten mit denen, die aus ihr hinausgefallen sind.“ (S. 51)
Die Afrikaner vom Oranienplatz werden schließlich auf verschiedene karitative Einrichtungen in der Stadt und am Stadtrand verteilt. In dieser Zeit beginnt unser Protagonist sich anhand einiger Bücher zu informieren und einen Fragenkatalog für die Gespräche mit den Flüchtlingen zu entwerfen. Und so lernen wir einige der jungen Männer kennen, die nach ihrer langen Flucht in Berlin gestrandet sind. Aus den Geschichten, die Richard hört und aufschreibt, ergeben sich weitere Fragen. Die jungen Männer wollen alle arbeiten, warum dürfen sie es nicht? Und die Afrikaner haben Fragen: Warum hat Richard keine Kinder? Das können sie nicht verstehen. „Meine Frau und ich, wir haben das so entschieden“, begründet Richard diesen Umstand (S. 204). Auch der Blick auf die Geschichte mit der Mauer zwischen Ost und West verwundert und provoziert die Frage, warum man Brüder und Schwestern durch einen Zaun gehindert hat, sich zu treffen?
Und wer schließlich die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer überlebt hat, ertrinkt später in einem Meer von Papier, denkt Richard, als er mit Ithemba zum Anwalt geht. Dort erfährt er auch, dass seine Freunde vom Oranienplatz nicht einmal eine Duldung haben „und selbst wenn sie eine hätten: So eine Duldung ist kein Aufenthaltsstatus“, sondern lediglich „eine Aussetzung der Abschiebung“ (S. 308f.). Der Aufenthalt der Afrikaner am Oranienplatz ist also dadurch definiert, dass sie gehen müssen.
Gedanken macht sich Richard auch über Dublin II. Diese EU-Verordnung besagt, dass immer jenes Land für die Flüchtenden zuständig ist, in dem sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten haben. Nur dort dürfen sie um Asyl bitten. Somit haben sich die europäischen Länder, die keine Mittelmeerküste besitzen, das Recht erworben, den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, nicht zuhören zu müssen. Richard, unsere Romanfigur, hört u. a. die Geschichte von Awad, der in Libyen aufgewachsen ist und dort zur Schule ging. Er hatte einen Vater und wohnte mit ihm zusammen in einem großen Haus. Eines Tages aber war alles anders, sein Vater wurde erschossen, Awad wurde von einer Militärstreife aufgegriffen. „Wenn du Glück hast, wirst du geschlagen, wenn du Pech hast, erschossen“, erzählt der junge Mann. Schließlich wurde er mit vielen anderen in ein Boot gesetzt. „Dann schossen sie eine Salve in die Luft und sagten zu uns: Wer zurückzuschwimmen versucht, wird erschossen. Wir wussten nicht, wohin das Boot fährt.“ (S. 79) Dies nur eine der vielen bewegenden Geschichten, die wir erfahren. Jenny Erpenbeck gelingt es, literarisch ansprechend die Schicksale der afrikanischen Flüchtlinge zu vermitteln. Die Hauptfigur des Romans wird dabei zum Pionier der „Willkommenskultur“, von der allerdings damals am Oranienplatz (4/2014) noch keine Rede war.
Erpenbeck, Jenny: Gehen, ging, gegangen. Roman. München: Knaus, 2015. 351 S., € 19,99 [D], 20,60 [A]
ISBN 978-3-8135-0370-8