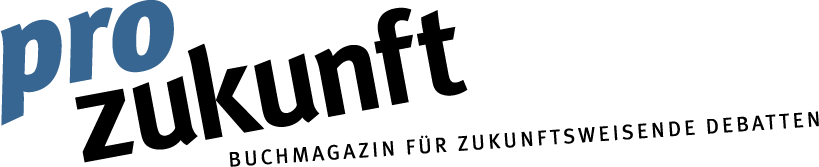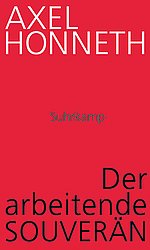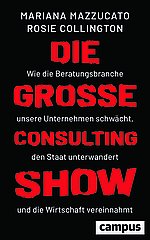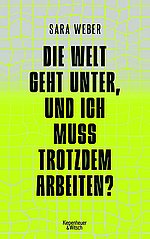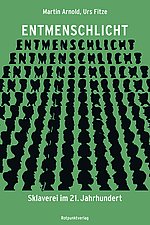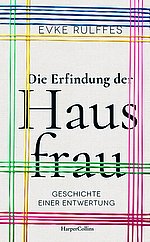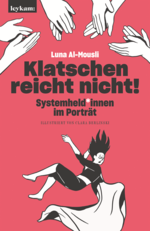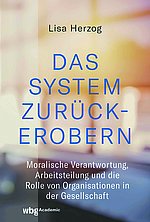
Unsere Gesellschaft ist eine hochgradig organisierte Gesellschaft und es ist eine Gesellschaft von Organisationen. Doch sind die Unzufriedenheit mit und das Unwohlsein in Organisationen groß. Organisationen sehen sich – insbesondere die hierarchisch verfassten alten Typs – wachsender Kritik konfrontiert. Mehr Agilität, also Fähigkeit zu schnellerem, flexiblerem Handeln, flachere Hierarchien, mehr interne Mitbestimmung, mehr Selbstorganisation oder gar demokratische Entscheidungsverfahren sind viel diskutierte Forderungen. Es ist also eine recht heterogene Gemengelage, die sich hinter dem Wunsch nach anderen, besseren Organisationen verbirgt.
Immer dann, wenn die Praxis unüberschaubar wird, ist Theorie gefragt. Denn Theorie setzt den Rahmen, in dem Dinge verhandelt werden. Lisa Herzog, Professorin für Politische Philosophie an der Universität Groningen, zieht den Rahmen nun weiter und setzt ihn anders. Sie legt den Fokus nicht darauf, wie Organisationen effizienter, schneller, flacher werden. Sondern sie wählt einen „explizit normativen Zugang: Ich konzentriere mich auf die moralische Dimension, die Organisationen gemeinsam haben.“ (S. 17)
Eine Erweiterung der Perspektive
Das ist eine klare Erweiterung der Perspektive. Organisation und Moral ist ein wenig erkundetes Feld. Trotz offenkundiger Fehler und Rechtsverstöße ist die moralische Dimension von Organisationen ein in der öffentlichen wie in der wissenschaftlichen Diskussion vernachlässigtes Thema, wie Herzog konstatiert. Moralische Verantwortung ist nicht die Perspektive, unter der Organisationen thematisiert werden. Und das ist ein Teil des Problems, der grundsätzliche. „Lange Zeit wurden Organisationen auf eine Art betrachtet, die blind für die moralischen Dimensionen des Organisationslebens war“, schreibt die Autorin (S. 19). Die Wirtschaftswissenschaften haben Menschen als rationale Nutzenmaximierer betrachtet und Organisationen unter rein funktionalen Aspekten behandelt. „Dieser moralfreie, funktionale Ansatz der Wirtschaftswissenschaften, der sich allein auf Effizienz konzentriert, ist bis in die Kapillaren des Organisationslebens eingesickert und hat dort moralische Fragen verdrängt.“ (S. 21). Die moralische Dimension wurde nicht nur nicht erörtert – sie wurde faktisch unsichtbar. Die funktionale Perspektive war die einzige, unter der Organisationen thematisiert wurden. Außen vor blieb der Mensch. Doch: „Organisationen werden schließlich von Menschen bevölkert und wo diese miteinander interagieren, ist die moralische Dimension stets präsent.“ (S. 86)
Der Aspekt der Moral im Mittelpunkt
Den Schwerpunkt auf die Moral zu setzen, geht nun keineswegs an den aktuellen Debatten um organisationalen Wandel vorbei, sondern stößt vielmehr zu ihrem Kern vor. Denn dabei geht es entscheidend darum, dem Menschen mehr Gewicht zu geben und sein Wissen, seine Kompetenz und seine Entscheidungsfähigkeit für die Organisation zu erschließen. Damit kann die Moral nicht länger ausgegrenzt werden. Lisa Herzog fordert daher, „dass Organisationen aus einer moralischen Perspektive neu gedacht werden müssen.“ (S. 23) Die entscheidende Frage für sie ist, „ob wir uns Organisationen auch anders vorstellen und sie auch anders gestalten können: Menschlicher und eher in Einklang mit den moralischen Normen, die wir in anderen Sphären unseres Lebens für selbstverständlich halten.“ (S. 22) Das meint: Das System zurückerobern.