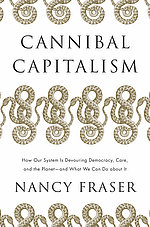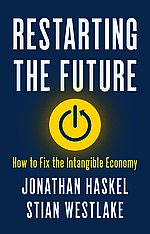„Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“ – so der Titel eines 2002 neu aufgelegten Buches des irischen, in Mexiko lehrenden Politikwissenschaftlers John Holloway. Präzise hatte der Autor bereits damals die Finanzkrise vorausgesagt. Der Konflikt der kapitalistischen Akkumulationsdynamik werde nur aufgeschoben durch die „Ausweitung des Kredits“, so Holloway damals. „Zunehmend mehr Schuldner geraten mit der Zahlung in Verzug, Kreditgeber (wie z. B. Banken) beginnen zusammenzubrechen und die Krise überstürzt sich in ihrer ganzen Intensität, mit all der damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung.“ (S. 224) Ein umfassender „Kreditzusammenbruch“ würde aber auch „die Existenz des Bankensystems und dadurch die existierende Struktur des Kapitalismus bedrohen“, so der Autor weiter (S. 226). Daher werde der klassische Krisenprozess immer wieder verzögert durch einen „Kreditgeber letzter Instanz“, der in der Lage ist, weiterhin Geld zu verleihen. „Der Kredit wird dann sehr viel elastischer, die Scheinwelt noch fantastischer.“ Eine wohl zutreffende Beschreibung der gegenwärtigen „Bankenpakete“ und „Rettungsschirme“!
Doch nun zum Hauptanliegen von Holloway. „Kapitalismus aufbrechen“ nennt er sein neues Buch, das den Gedanken des ersten weiterführt, nämlich dass die Transformation heute nicht mehr durch eine große Revolution denkbar sei, sondern nur mehr durch viele und vielfältige Initiativen, die sich der kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen versuchen. An einem Bild von Edgar Allen Poe verdeutlicht der Autor seine Strategie: Menschen befinden sich in einem Raum ohne Türen und Fenster. Die Wände bewegen sich auf die Menschen zu und verengen somit deren Lebensraum. Während viele dies gar nicht wahrnehmen und noch immer damit beschäftigt sind, Rangordnungen untereinander sowie in der Anordnung der Möbel herzustellen (klassischer Reformismus), andere wiederum, die das Näherrücken der Wände wohl wahrnehmen, aber nur darüber nachdenken, wie die Wände entfernt werden könnten (klassische Revolution), würden Dritte – und diesen zählt sich Hollaway zu – nach Rissen in den Mauern suchen, um diese zu durchbrechen. Dabei gehe es um Verweigerung („Der Schlüssel unserer Emanzipation, der Schlüssel zum vollen Menschsein ist einfach: verweigere, sei ungehorsam“ (S. 13) und um ein anderes Tun, um Tätigsein statt entfremdende Lohnarbeit im Sinne von Marx.
Diese „Bewegung der Verweigerung-und-des-Anders-Schaffens“ (S. 12) erkennt Holloway in sehr unterschiedlichen Manifestationen – von den Arbeitern, die sich jenseits der Erwerbsarbeit nichtkommerzielle Freiräume erhalten über die vielen Menschen in kritischen NGOs bis hin zu den lokalen Befreiungsbewegungen etwa in Lateinamerika, die sich gegen den Zugriff durch die kapitalistische Landnahme wehren. „Unsere Methode ist das Aufbrechen“, schreibt Holloway. „Wir wollen die Wand nicht in ihrer Festigkeit, sondern in ihrer Brüchigkeit verstehen.“ (S. 15) „Kapitalismus aufbrechen“ heiße damit, „die Brüche tiefer und weiter treiben, vervielfachen, und dafür sorgen, dass sich die Bruchlinien verbinden“ (S. 17).
Embryonen des Neuen
Krisen betrachtet der Autor als Zuspitzung von Konflikten. Das gegenwärtige System von Arm und Reich, die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen erzeuge eine „Welt der Frustration, der vergeudeten Möglichkeiten“ (S. 9). „Menschheit, Menschsein, Menschlichkeit beißen sich immer mehr mit dem Kapitalismus. Sich einzufügen, einen Platz zu finden, wird schwieriger.“ (S. 15) Auch wenn die Vorstellung einer anderen Welt für viele noch nicht denkbar ist, würde diese bereits in „einer Million Experimenten“ ausprobiert. Das sei auch nicht neu: „experimentelle Vorwegnahmen einer anderen Welt sind wahrscheinlich so alt wie der Kapitalismus“ (S. 17). Wir können nicht mehr auf die „große Revolution“ warten, sondern müssen anfangen, „hier und jetzt etwas anderes zu schaffen“, so Holloway. Und diese Experimente könnten die „Embryonen einer neuen Welt sein, die Bewegungen in den Fugen der alten Gesellschaft, aus denen vielleicht eine neue erwächst“ (ebd.). Dafür bräuchten wir ein anders Tun, aber auch ein anderes Denken, das „Erlernen einer neuen Sprache“, ein „Fragen-während-wir-gehen“ (S. 19). Die revolutionäre Ersetzung des einen Systems durch ein anderes hält der Autor „weder möglich noch wünschenswert“ (S. 18).
In seiner Abhandlung macht Holloway zunächst Konfliktlinien für dieses „Aufbrechen“ aus. Er nennt den Staat, der sich in Krisensituationen auf die Seite des Kapitals schlagen kann (Stichworte wie „Postdemokratie“ oder „Steuerungskrise“ belegen dies), unsere eigenen persönlichen „Schwächen“, die zu neuen Machtstrukturen auch innerhalb der Bewegungen führen können (Holloway setzt dem basisdemokratische Ansätze entgegen) und schließlich – als entscheidende Barriere – der „Wert“ bzw. das „Geld“. Nicht der Staat schaffe die gesellschaftliche Synthese, auch wenn er sich oft so darstellt, die „tatsächliche Kraft, die alles zusammenhält“ sei die „Bewegung des Geldes“. „Das Geld als die Kraft, die die Gesellschaft vereinheitlicht und zusammenhält, macht den Kapitalismus so gallertartig, so puddinghaft“, meint Holloway pointiert (S. 72). Er spricht von der „Herrschaft der billigen Ware“ (ebd.), der „Zwickmühle des Arbeitsmarktes“ (S. 74) sowie von der Abhängigkeit der Wertproduktion auch in der „Alternativen Ökonomie“. Der Autor beschreibt etwa Arbeiterkooperativen, die in Argentinien marode Betriebe in Selbstverwaltung übernommen haben, dabei aber dennoch vom Markt abhängig bleiben, auch wenn nach Tauschformen innerhalb solcher Betriebe gesucht wird. Das Ziel müssten jedoch „gesellschaftliche Bindungen“ sein, die auf „Vertrauen, Solidarität, Großzügigkeit, Schenken beruhen“ (S. 76). Eine Utopie, die vorerst wohl nur mehr in wenigen Subsistenzkulturen zu finden ist.
Nützliches Tätig-Sein
Der Hauptteil des Buches widmet sich folgerichtig der Auseinandersetzung mit der „abstrakten Arbeit“ – sozusagen der gekauften Arbeitskraft, die sich dann Produkte kaufen kann –, der Holloway die „Bewegung des nützlichen Tätigsein“ (S. 196) entgegensetzt. Ein „Drängen nach Selbstbestimmung“ macht dieses Tätigsein aus, das sich im Backen eines Kuchens für Freunde oder im Anlegen eines Gemeinschaftsgartens ebenso manifestieren könne wie im Einsatz für die Zurückgewinnung der kommunalen Wasserversorgung oder dem gemeinsamen Lesen und Diskutieren von Büchern. Der „Doppelcharakter von Arbeit“ ermögliche – wenn zunächst auch in Grenzen – das Ausbrechen aus den Abhängigkeiten des kapitalistischen Arbeitsmarktes, wodurch sich für Holloway der Kreis schließt zu seiner „Strategie des Aufbrechens“ – in anderen Worten, dem Bestreben, „dem Fluss des Tätigseins gegen und über seine Versteinerung in der Arbeit zu folgen“ (S. 209).
Manche mögen denken, es handle sich hier um schöne Worte, die abgehoben von der Wirklichkeit der Menschen dahingesagt sind. Ich sehe es anders: Wortgewandt und in reicher Bildersprache erinnert der Autor an eine Utopie nicht entfremdenden Tätig-Seins in und für die Gemeinschaft jenseits der abstrakten Warenwelt. Er reiht sich damit ein in die Tradition einer Philosophiegeschichte, die den real existierenden Kapitalismus in seinen Tiefenstrukturen kritisiert – aber nicht nur kritisiert, sondern dem ein Anders-Sein entgegensetzt. H. H.
Holloway, John: Die Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2010 (4. Aufl.). 254 S., € 24,90 [D],
25,40 [A], sFr 42,30 ; ISBN 978-3-89691-514-6
Holloway, John: Kapitalismus aufbrechen. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2010. 276 S., € 24,90 [D], 25,40 [A], sFr 42,30
ISBN 978-3-89691-863-5