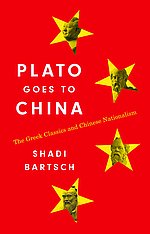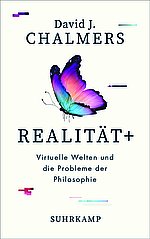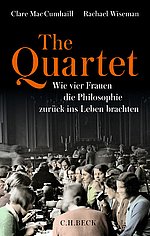Basierend auf einer Vorlesungsreihe aus dem Jahr 2014, geht Terry Eagleton in dieser Publikation der Bedeutung des Begriffs Hoffnung nach und durchschreitet dabei engagiert und erhellend die Bereiche Politik, Philosophie, Theologie und Literatur.
Gekonnt wird zunächst ein epochen- und disziplinübergreifender Bogen gespannt, der unterschiedliche Rezeptionsmechanismen des Begriffs Optimismus veranschaulicht. Ausdrücklich betont Eagleton die Notwendigkeit, Optimismus als angeborene Fröhlichkeit, als Temperament zu verstehen und strikt von Hoffnung als einer erlernbaren Tugend abzugrenzen.
Offenkundig identifiziert sich der britische Literaturtheoretiker mit christlichen und marxistischen Positionen, die er als nicht-optimistisch, aber als hoffnungsvoll charakterisiert. Was aber begründet Hoffnung? Die Auseinandersetzung mit der Frage beleuchtet mannigfaltige Sichtweisen intellektueller Größen wie Aristoteles, Freud und Keats. Dezidiert geht Eagleton dabei auch auf die Ähnlichkeiten zwischen Hoffen und Wünschen ein. Beides ist meist zukunftsorientiert, widmet sich also Zielen, die es noch nicht gibt. Allerdings fußt Hoffen auf rationalen Gründen, den erdachten Szenarien wohnt die Möglichkeit der Realisierung inne: „Unmöglichkeit macht das Hoffen zunichte, aber nicht das Wünschen: Es kann Sie danach verlangen, den gegenwärtigen Diktator von Nordkorea in einen Schwulenclub in Denver zu locken, während Ihnen gleichzeitig klar ist, dass Ihr Wunsch sinnlos ist.” (S. 90)
Die authentischste Form von Hoffnung entspringt nach Eagleton einer die totale Katastrophe als mögliche Option anerkennenden Haltung. Dem folgend benennt er die Tragödie als exemplarischen Fall von Hoffnung par excellence. In Bezugnahme auf Shakespeare bietet der Autor Literaturanalysen einiger Dramen, um schließlich zu konkludieren: „Solange es gelingt dem Unheil eine Stimme zu geben, ist es nicht das letzte Wort. Die Hoffnung stirbt erst, wenn wir Grausamkeit und Ungerechtigkeit nicht mehr als das erkennen können, was sie sind. Von Hoffnung zu sprechen setzt logisch den Begriff Hoffnung voraus. Erst wenn die Hoffnung selbst erlischt, ist keine Tragödie mehr möglich.” (S. 207) Wie Wittgenstein erklärt Eagleton also Sprache als unabdingbar für Hoffnung.
Weitere Beobachtungen und Analysen, darunter auch eine intensive Kritik an Ernst Blochs Prinzip Hoffnung, zeigen sich mit humoristischen Beiträgen gespickt. Die deutsche Fassung von „Hope without Optimism“ wird damit zu einer interessant-amüsanten Lektüre und stellt einmal mehr Eagletons stupendes Wissen unter Beweis. In vielen Teilen mag sie allerdings ob der Informationsdichte auch überladen wirken.