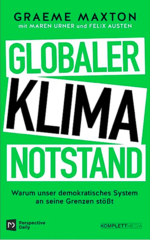„Der Verbraucher hat die Macht“, „Es liegt an uns als Bürger und Bürgerinnen, unser Verhalten zu ändern“, „Doch wer will schon verzichten“. Diese und ähnliche Argumente sind häufig zu hören, wenn es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Michael Kopatz vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie hat hier eine andere Sicht. In seinem Buch „Schluss mit der Ökomoral. Wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken“ macht er zahlreiche Vorschläge, wie es die Politik in der Hand hätte, uns zu besseren Menschen zu machen. Der Begründer des Konzepts der „Ökoroutine“ plädiert dafür, die Verhältnisse zu verändern –dann verändere sich das Verhalten der Menschen von selbst. Und er plädiert für Maßnahmen, die schrittweise eingeführt werden, das erhöhe die Akzeptanz. Als Beispiel nennt er strengere Vorschriften für die Hühnerhaltung: Würden diese jährlich verschärft, würde es der Konsument kaum merken.
Umfragen konstatieren zwar ein großes Umweltbewusstsein. Für zwei Drittel der Befragten ist Umweltschutz eine grundlegende Bedingung, um Zukunftsaufgaben bewältigen zu können, so das Umweltbundesamt Berlin. Doch die Studie zeigt zugleich, dass nach wie vor 70 Prozent aller Befragten täglich oder mehrmals die Woche mit dem Auto fahren. Zugleich erklären 91 Prozent, dass das Leben besser wäre, wenn sie nicht aufs Auto angewiesen wären. 61 Prozent in Großstädten würden sogar sofort auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Kopatz dazu: „Jeder für sich genommen kann nicht die Strukturen verändern, die das gewünschte Verhalten ermöglichen. Niemand ändert seine Autoroutine, wenn der Nahverkehr teurer und langsamer ist. Die Voraussetzungen können nur Stadt- und Verkehrsplaner schaffen.“ (S. 22) Nur mit mehr und breiteren Radwegen, einem attraktiven Öffentlichen Verkehr sowie der Begrenzung der Flächen für Autos gelingt es nach dem Experten, den Umstieg hinzukriegen. Dazu brauche es intelligente Lösungen: etwa Parkgebühren, bei denen an den Automaten informiert wird, dass die Einnahmen direkt der Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs zugutekommen. Kopatz nennt das „PayBack“. In seiner Heimatstadt Osnabrück, wo Kopatz im Stadtrat tätig ist, wurde der Vorschlag bislang leider nicht aufgegriffen. Und in anderen Städten wird nicht weniger um jeden Autoparkplatz gerungen. Wo der Umschwung gelingt, profitieren aber alle davon. Etwa in Groningen. „In die City der niederländischen Stadt kommt man nur sehr schlecht mit dem Auto, aber sehr gut mit dem Rad und Bus“, berichtet Kopatz: „Und so machen das die Leute dann auch.“ (S. 86)
Alle können gewinnen, aber wir brauchen Limits und bessere Standards
Absurd findet der Nachhaltigkeitsforscher das Argument, man müsse Verkehrspolitik „ideologiefrei“ diskutieren: „Über 40 Jahre haben Politik und Verwaltung das Leitbild der autogerechten Stadt verfolgt. Viele Planer tun es noch bis heute. Ist diese über Jahrzehnte währende und bis heute allgegenwärtige Straßenbaupolitik ideologiefrei?“ (S. 99), so Kopatz. Nicht weniger irritierend sei die Forderung der Autolobby, Auto, Rad und Bus müssten gleichberechtigt sein: „Ist es denn gerecht, dass rund 80 Prozent der Verkehrsfläche ausschließlich von Autos genutzt wird?“ erwidert Kopatz. Und sei es hinnehmbar, dass täglich mindestens ein Radfahrender im Straßenverkehr getötet wird? Doch so paradox es zunächst klingen mag, bedeute mehr Platz für Radfahrende auch mehr Platz für das Auto, weil eben bedeutend weniger davon unterwegs wären, so Kopatz weiter. Das Radfahrerland Niederlande bestätige dies seit vielen Jahren. Und die Innenstadtgeschäfte würden nachweislich besser florieren. Die notwendigen Maßnahmen sind alle am Tisch: Tempolimits, Ausweitung von Parkgebührenzonen, Umwidmung von Autoparkplätzen auf solche für Radfahrende oder für Grünflächen, Busspuren zumindest vor Ampelkreuzungen sowie günstige Flächenticktes für den Öffentlichen Verkehr. Kopatz geht aber noch einen Schritt weiter und plädiert auch für ein Moratorium des Ausbaus der Autoinfrastrukturen – und auch jener für den Flugverkehr. In Singapur gibt es mittlerweile sogar Limits für die zugelassenen Autos – nur wenn ein altes abgemeldet wird, darf ein neues angemeldet werden, und zwar mit einer hohen Gebühr. Die hohe Gebühr für Privatautos gibt es laut Kopatz auch in Dänemark, und dort werde das mittlerweile als ganznormal angesehen.
Ein nachhaltiges Leben ohne Limits sei nicht mehr denkbar, so Kopatz auch in Bezug auf andere Bereiche wie Ernährung, Bauen und Güterkonsum. Seine Ansage: „Ohne Limits ist es unmöglich, diesen Planeten mit demnächst zehn Milliarden Menschen auskömmlich zu bewirtschaften. Wenn wir zu dieser Einsicht nicht bereit sind, gehen die Demokratien zugrunde.“ (S. 38) Die Wirtschaftsforschung und die Politik müssten sich auf ein Ende des Wachstumsdenken einstellen, so Kopatz. Es sei dringend notwendig zu klären, „wie sich der Wohlstand bewahren lässt – auch wenn in der Republik nur noch halb so viele Autos fahren und wenn unsere Geräte wieder so lange halten würden wie früher“ (S. 35) Es gehe nicht um einen generellen Wachstumsstopp: „Das Gute darf wachsen, das Schlechte muss schrumpfen.“ (ebd.) Wohlstand bedeute dabei aber nicht, immer mehr zu besitzen, sondern ein auskömmliches Leben für alle, so der Experte mit Verweis auf die Zufriedenheitsforschung. Seit den 1980er-Jahren habe sich der materielle Wohlstand in Deutschland verdreifacht, die Zufriedenheit sei aber gleichgeblieben: „Glück kann nicht wachsen.“ (S.33)
Wenig Hoffnung setzt Kopatz in die Mündigkeit der Konsumenten und Konsumentinnen. Sie würden immer größere Autos kaufen, sich aber beschweren, wenn Parkgebühren oder der Treibstoff teurer wird. Und auf den immer ausgeklügelteren und teureren Grillgeräten würde nach wie vor das Billigstfleisch landen. Nachhaltiger Konsum friste noch immer ein Nischendasein und das werde so bleiben, solange allein auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Wir seien eben Routinewesen und die meisten von uns würden sich nur ändern, wenn es verlangt wird oder zumindest attraktiver als das nicht nachhaltige Verhalten ist, so die zentrale Botschaft des Nachhaltigkeitsforschers. Wir seien zudem perfekte Verdrängungskünstler. Während wir unsere Haustiere verhätscheln – der ökologische Fußabdruck unserer Hunde und Katzen sei enorm –, würden wir weiterhin das Fleisch aus den Massenställen verzehren und das immense Tierleid in Kauf nehmen. Aber, und das ist die Hoffnung, des Experten: „Wenn nicht das persönliche Verhalten zur Disposition steht, sondern die Rahmenbedingungen insgesamt, sind die Menschen durchaus vernünftig.“ (S. 67) Neben Limits plädiert Kopatz daher auch für Standards, die für alle gelten müssen. Das helfe auch den Unternehmen, weil es dann eben gleiche Marktbedingungen für alle gäbe. „Wir würden es sehr begrüßen, wenn ein Gesetz beschlossen würde, das einen höheren Standard bei der Tierhaltung verpflichtend vorschreibt, am besten EU-weit“, zitiert Kopatz den Chefeinkäufer von Aldi Süd Deutschland. Allgemein gültige Ökostandards brauche auch der Industriesektor. Nur Vorschriften für die Reparaturfähigkeit von Geräten, die verpflichtende Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie längere Gewährleistungsfristen würden langlebigen Gütern eine Chance am Markt geben.
Wie kommen wir zur Veränderung?
Michael Kopatz ist überzeugter Demokrat. „Ich möchte, dass die Veränderungen, über die ich schreibe, auch Realität werden“ (S. 200), sagt er zu seinem ehrenamtlichen Mandat im Stadtrat von Osnabrück. Kopatz bricht eine Lanze für die Akteure in der Politik, fordert aber ein reformiertes Parteispendenwesen sowie das Verbot von Nebentätigkeiten für Bundestagsabgeordnete. Er betont die Aufgabe des Staates, wenn es um Agenden von allgemeiner Bedeutung geht: „Klimahitze und Umweltgifte sind kollektive Selbstverletzungen der Menschheit. Die Entscheidung darüber darf man nicht den Einzelnen überlassen.“ (S. 204). Es sei gerade die Errungenschaft der Demokratie, kollektive Probleme durch Gesellschaftsverträge zu lösen. Vieles sei mittlerweile auf europäischer Ebene besser zu lösen, daher brauche es auch ein entsprechendes Interesse an der EU und ihrer Politik. Nicht zuletzt hofft der Nachhaltigkeitsexperte auf ein zunehmendes zivilgesellschaftliches Engagement von Initiativen und Gruppen – als Beispiel nennt er die Deutsche Umwelthilfe, die viele Themen wie den Abgasskandal der deutschen Automobilindustrie ins Rollen gebracht habe. Notwendig sei die Verknüpfung von Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wirtschaftlichen Strukturwandel habe es immer gegeben, doch es lassen sich gute Lösungen finden. Denn in Summe gelte: „Höherer Standards und Limits für alle sind fairer“ (217). Neue Ökoroutinen würden das nachhaltige Leben nicht nur einfacher, sondern für alle selbstverständlich machen. Dann brauche es eben nicht länger Appelle an die Moral. Und gewisse Dinge seien gänzlich zu überwinden: „Ein Menschenrecht auf Billigflüge gibt es nicht.“ (S. 51)