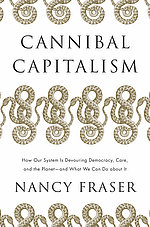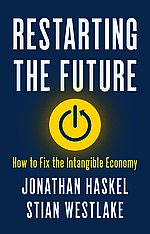Das Erfrischende an Zizek ist, dass er neu argumentiert. Entweder, weil er Neues zu sagen oder weil er Bekanntes in neuer Form darstellt. Meistens ist es die Form der Provokation.
„Ein Plädoyer für die Intoleranz“ beinhaltet beides. Sowohl bei den Argumenten ist Neues zu finden als auch die Form ist radikaler, als sie anderswo üblich wäre.
Im Kern des Arguments von Zizek steht ein Begriff der Politik, den er sich bei Rancière entleiht. Der politische Konflikt ist dabei die Spannung zwischen der strukturierten Gesellschaft und dem „Anteil der Anteillosen“. Klassen gehören dabei zur strukturierten Gesellschaft, die Anteillosen hingegen erschüttern die Gesellschaft, da sie sich in der Geschichte immer wieder als Platzhalter des Ganzen, der wahren Allgemeinheit präsentieren. Die Identifikation des Nicht-Teils mit dem Ganzen sei die elementare Geste des Politischen. (S. 28)
Für die Gegenwart erkennt Zizek eine Post-Politik, wie er es nennt. Die Post-Politik hat den Multi-Kulturalismus als Ideologie, die „Einheit im Unterschied“ proklamiert, die Koexistenz unterschiedlicher Gruppen wünscht, die Abschaffung des Antagonismus sieht, Politik als pragmatische Suche nach Lösungen erfindet. Die Toleranz ist nach Zizek die Aufrechterhaltung des Ganzen in seiner aktuellen Struktur. Sie schließt damit die Geste der Politisierung im Sinne Rancières aus.
Zizek macht sein Argument greifbar, wenn er erzählt, dass diskriminierte Menschen zwar katalogisiert, toleriert und verwaltet werden. Die eigentliche politische Geste, nämlich zu artikulieren, was bei ihm „`falsch´ läuft `metaphorisch´ zu erhöhen und dadurch zu einem Platzhalter für das machen, was allgemein als `Falsches´ Geltung besäße“, wird aber unmöglich gemacht (S. 47). Zizek: „Was die Post-Politik zu verhindern sucht, ist genau diese metaphorische Universalisierung partikularer Forderungen“ (S. 48). Partikularer Inhalt darf keine generelle System-Opposition hervorbringen.
Multi-Kulturalismus ist für diese Post-Politik adäquat. Mit der postmodernen „Identitätspolitik“ geht es schließlich genau um das Behaupten der partikularen Identität, „des rechten Platzes eines jeden in der gesellschaftlichen Struktur“ (S. 56). Multi-Kulturalismus und Fundamentalismus seien in diesem Hervorheben des Partikularen verwandt: „Die Trennlinie zwischen multi-kulturalistischer Identitätspolitik und dem Fundamentalismus ist folglich bloß formal; oft beruht sie einzig und allein auf der andersgearteten Perspektive, von der aus ein Beobachter eine Bewegung betrachtet, die sich für die Aufrechterhaltung ihrer Gruppen- identität einsetzt“ (S. 59)
Für Zizek liegt die Identitätspolitik grundsätzlich falsch. Die partikularen Wurzeln sind für ihn der „phantasmatische Schirm, der die Tatsache verschleiert, dass das Subjekt immer schon durch und durch `entwurzelt´ ist, dass seine wahre Position diejenige der Leere der Universalität ist.“ (S. 71) Zizek erinnert hier auch an den heutigen Kapitalisten, der immer noch einem partikularen Kulturerbe (z. B. deutsche oder japanische „Tugenden“) anhängt, es als die geheime Quelle seines Erfolges ausgibt und sich mit diesem der universellen Anonymität des Kapitals hinwegtäuscht. An diesem Beispiel wird auch klar, was Zizek mit der Entpolitisierung des ökonomischen Bereichs beklagt: Das „überall lauernde Gerede über neue Formen der Politik“ (S. 92) beziehe sich auf partikuläre Angelegenheiten, es sorge dafür, dass etwas nicht gestört wird, was allein zählt: die Ökonomie.
Der Autor spitzt weiter zu, wenn er sich fragen lässt: „Was immer ich tue, es ist also falsch – entweder bin ich zu tolerant gegenüber der Ungerechtigkeit unter der der Andere leidet oder ich erlege ihm meine eigenen Werte auf? Was willst du von mir, dass ich tun soll?“ Zizeks Antwort: „Nichts! Solange du an den falschen Voraussetzungen kleben bleibst, sollst du tatsächlich gar nichts tun!“ Jede der beiden Kulturen, die an der Kommunikation beteiligt sind, seien in ihrem eigenen Antagonismus gefangen (S. 77). Es gibt keine Möglichkeit der Neutralität im Verhältnis zu diesem Gegenüber, ohne sich auf eine Seite geschlagen zu haben. Anstatt das Motto „Jeder und jede an seinen oder ihren Platz“ zu akzeptieren, gehe es um die Infragestellung der konkreten existierenden allgemeinen Ordnung. Und zwar aufgrund ihrer Symptome, die keinen „eigentlichen Platz“ in ihr finden. Hier ist wieder Rancìere: Politik als die Identifikation des Nicht-Teils mit dem Ganzen, die Inanspruchnahme einer Universalität. Das Bild dazu ist der demos im antiken Griechenland: Nicht weil er die Mehrzahl der Bevölkerung umfasste, nicht weil er den untersten Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie besetzte, sondern weil er keinen eigentlichen Platz in dieser Hierarchie hatte, stand er für das Universale ein (vgl. S. 86). S. W.
Zizek, Slavoj: Ein Plädoyer für die Intoleranz. Wien: Passagen Verl., 2013. 99 S., € 15,- [D], € 15,50 [A], sFr 21,- ; ISBN 978-3-709-200797