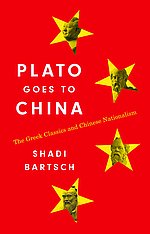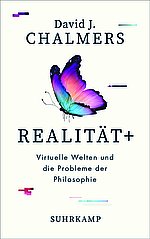Die Arbeit und ihr Schicksal:
Die Arbeit und ihr Schicksal:
Wir haben das Kapitel begonnen mit der Diagnose der erschöpften Gesellschaft. Schließen wollen wir mit einem Band des aktuellen Philosophicum Lech, das diesmal dem „Mut zur Faulheit“ gewidmet war. „Wie wäre es, die soziale Anerkennung nicht den Müßiggängern und Faulen zu verweigern, sondern den Hektikern, Beschleunigern und Rund-um-die-Uhr-Erreichbaren?“ (S. 17f.), fragt Herausgeber Konrad Paul Liessman provokant in der Einleitung zum Band. „Zu faul, um mitzumachen. Auch das könnte eine zeitgemäße Maxime sein“ (S. 19), fordert er im Hinblick auf Trends wie den Konsumismus, die „überbordende Informationsflut“ oder die sozialen Medien.
Gedanken wie diese könne sich nur ein Philosoph leisten, könnte man einwenden. In der Tat: die Beiträge des Bandes bewegen sich auf einem Niveau, das dem gegenwärtigen Wirtschaftsleben diametral entgegensteht. Und doch findet man wertvolle Anregungen. Ulrich Körtner etwa zeigt die Herleitung des modernen Berufs- und Arbeitsethos aus dem Calvinismus und aus Max Webers Denken auf. Er kommt dabei zum Schluss, dass Arbeit und Muße seit Beginn an zusammengedacht wurden, heute jedoch zwischen Beruf und „Job“ unterschieden und Freizeit immer mehr als Aktivsein wahrgenommen werde. Aus ökonomischer Perspektive basiere der Sozialstaat auf Erwerbsarbeit, aus theologischer Sicht sei dies nicht so eindeutig: „Die Würde des Menschen und das Recht auf Leben bestehen unabhängig von allen Leistungen. Arbeit ist bestenfalls das halbe Leben.“ (S. 47)
Philosophie der Faulheit
Nassima Sahraoui plädiert angesichts der Hyper-Produktivität und permanenten Beschleunigung im modernen Kapitalismus für eine „Philosophie der Faulheit“ (S. 69). Ausgehend von Marx‘ Diktum „Reichtum ist verfügbare Zeit und sonst nichts – wealth is disposable time and nothing more“ fordert sie die „Verfügbarmachung von Zeit“ als Wohlstandsziel. Dabei gehe es nicht um passive Trägheit, sondern um eine notwendige Bedingung für die Entwicklung innerer Potenziale. Das Sich-Zurücknehmen aus ökonomischen Zwängen könne so als „Moment der Tätigkeit in Untätigkeit, als aktives Moment im Inaktiven gelesen werden.“ (S. 88)
Der Soziologe Stephan Lessenich fokussiert in seinem Beitrag auf den von Daniel Bell in den 1960er-Jahren diagnostizierten und auch befürchteten Paradigmenwechsel von der „industriellen Leistungs- zur postindustriellen Spaßgesellschaft“ (S. 170), in der nicht mehr ehrliche Leistung, sondern „anstrengungsloser“ Erfolg zähle. Dem setzt Lessenich den „neosozialen Geist des Kapitalismus“ (S. 173) im Kontext des „aktivierenden Sozialstaats“ ab den 1980er-Jahren entgegen. Selbst-Verwirklichung sei in dieser Lesart umgedeutet worden zur Selbst-Aktivierung: Das Soziale werde somit privatisiert bzw. subjektiviert, „zum Gegenstand selbstdisziplinierender Selbstverwirklichung des Aktivbürgers erklärt“ (S. 176). In diesem Sinne müsse nicht nur vom neuen Geist des Kapitalismus, sondern könne auch von einem neuen „Geist des Laboralismus“ (S. 178) gesprochen werden.
Sophie Loidolt erinnert an Hannah Arendts „Vita activa“ und deren Dreiteilung in „Arbeit“ – verstanden als Verrichten der alltäglichen Erledigungen im Haus –, „Herstellen“ von Dingen in der Welt der Produktion sowie „Tätig-Sein“ als politisches Handeln. Die Logik von „Produzieren“, „Konsumieren/Vernichten“ und „Mehrwert“ (S. 134) sei nun zum bestimmenden Maßstab des Kapitalismus mit all seinen ökologischen Folgen geworden und habe mit dem Herstellen der zum Leben nötigen Güter nur mehr bedingt zu tun, so Loidolt. Und Politik werde nicht mehr verstanden als „Sorge um die Welt“ in einem „existenziellen Grundverhältnis des aktiven Selbstseins mit anderen“ (S. 135), wie Arendt gemeint habe, sondern als pragmatische „Haushaltsorganisation“, „Kommunikationsstrategie“, „Selbstvermarktung“ der politischen Akteure – und vor allem als „Aufgabe von denen da oben“. Freiheit bedeute in diesem Sinne „eher Freiheit von Politik als zu Politik“. Sinn suche das „animal laborans“ der Konsumgesellschaft in der Zerstreuung, während es Arendt bei sinnvollem Tätigsein „um die Welt“ gegangen sei (S. 137).
Digitalisierung der Arbeit
Weitere Beiträge widmen sich dem Thema „Konsum als Arbeit“, bekannt auch als IKEA-Prinzip (Wolfgang Ullrich), sowie einer ebenfalls aus Skandinavien stammenden neuen Lebensform namens „Hygge“, die – so der Leiter des Goethe-Instituts Warschau Christoph Bartmann – auf einer pragmatischen Einstellung basiere: „Beschränkung ohne Verzicht, Einfachheit ohne Askese, Komfort ohne Aufwand“ (S. 221), was ebenso dem propagierten Lifestyle von IKEA zugeschrieben werde.
Einen politisch pragmatischen Kontrapunkt zu den philosophischen und sozialwissenschaftlichen Ausführungen setzt schließlich der österreichische Arbeitsrechtler und Berater verschiedener österreichischer Regierungen, Wolfgang Mazal. Anders als manche prognostizieren, würde auch trotz Digitalisierung die Arbeit nicht ausgehen, so seine Meinung. Der demografische Wandel erfordere das Füllen der demografischen Lücke am Arbeitsmarkt, die alternde Gesellschaft werde zudem zu bedeutend größerem Betreuungsaufwand führen. Mazal plädiert für einen erweiterten Arbeitsbegriff, der Sorgetätigkeiten aufwertet, und – als Sofortmaßnahme gegen Arbeitslosigkeit – für den Abbau von Überstunden. Allein für Österreich beziffert der Autor jährlich gut 200 Millionen geleistete Überstunden, die etwa 200.000 Vollarbeitsplätzen entsprächen. (vgl. S. 201)
Die gegenwärtige Konsumgesellschaft ist keineswegs der Endpunkt kultureller Entwicklung, das Leistungsethos in seiner Ambivalenz alles andere als überwunden – so ließe sich der Band zusammenfassen.
Von Hans Holzinger
![]() Mut zur Faulheit. Die Arbeit und ihr Schicksal. Philosophicum Lech. Hrsg. v. Konrad P. Liessmann. Wien: Zsolnay, 2018. 270 S., € 22,- [D], 22,60 [A] ISBN 978-3-552-05889-7
Mut zur Faulheit. Die Arbeit und ihr Schicksal. Philosophicum Lech. Hrsg. v. Konrad P. Liessmann. Wien: Zsolnay, 2018. 270 S., € 22,- [D], 22,60 [A] ISBN 978-3-552-05889-7