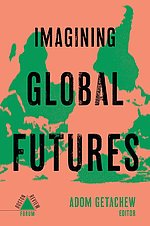Seit die Bildungsminister der EU-Staaten 1999 den Umbau des europäischen Hochschulsystems beschlossen haben, gibt der „Bologna-Prozess“, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit der Union erhöht, die berufliche Anschlussfähigkeit verbessert und die wechselseitige Anerkennung der Bachelor- und Master-Diplome erreicht werden sollen, immer wieder Anlass zur Diskussion. Haben die neuen Studienregelungen bloß zu einer Verlängerung der Schulbank geführt? Sind Studierende „ungebildet, unpolitisch und vor allem karrierefixiert“, wie Kritiker immer wieder behaupten?
Differenziert und faktenreich widmet die DIE ZEIT. 2009. Nr. 18, S. 63 ff.) dem „Bologna“-Prozess hochinteressante Beiträge.
Während Richard Münch, einer der prominentesten Kritiker, etwa bemängelt, dass infolge der Reform „außeruniversitäres Engagement wertlos“ und die „Attraktivität von Vorlesungen nicht mehr an Erkenntnisgewinn, sondern am Punktewert (den „Credits“) gemessen werde“, zeigt sich Heinz-Elmar Tenorth angetan: „Studenten haben jetzt einen besseren Überblick darüber, was von ihnen verlangt wird, sind wissbegierig, bildungsorientiert und fleißig“, meint der Berliner Bildungshistoriker und warnt vor einer „Idealisierung der Vergangenheit“ (S. 64). Einen „Mentalitätswandel“ und gar eine „Kulturrevolution an Deutschlands Hochschulen“ meint Jan-Martin Wiadra zu erkennen, der sich in Tübingen – wo jeder vierte Einwohner immatrikuliert ist (!) – genauer umgesehen und mit Studierenden und Lehrenden gesprochen hat. Positives weiß etwa die Germanistin Christine Renz vor allem über den Bachelorabschluss zu sagen, und ärgert sich darüber, „dass wir eine Studienreform schlecht reden, bevor wir ihre Folgen abschätzen können“.
Weniger skeptisch sind andere den Vorzügen der europäischen Bildungsreform auf der Spur. „Tuning USA“ ist der Titel eines Pilotprojekts, mit dem amerikanische Universitäten viele Elemente von „Bologna“ modifiziert übernehmen, denn Europa, so heißt es, „entwickelt sich zu einem gefürchteten Konkurrenten der amerikanischen Hochschulen im Wettstreit um die klügsten Köpfe – weltweit“ (DIE ZEIT. 2009. Nr. 16, S. 65). Ob in Anbetracht dieser geballten Konkurrenz die internationale Forschungselite, wie Anton Zeilinger meinte – der renommierte Experimentalphysiker ist Initiator der ersten, kürzlich eröffneten Eliteuniversität in Österreich – bald „neidisch“ nach Maria Gugging blicken werden, bleibt abzuwarten – und wirft zugleich die nicht unerhebliche Frage auf, ob Missgunst eine wünschenswerte Kategorie wissenschaftlichen Fortschritts darstellt. W. Sp.
Zukunft von Studierenden
Die Zweiklassengesellschaft an Hochschulen ist Realität: Während in Deutschland 44% der Studierenden keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und sich auf das Studium konzentrieren können, arbeiten 26% mehr als 12 Stunden pro Woche; die Erwerbstätigkeit liegt im Durchschnitt bei 6 Stunden wöchentlich.
Nach Erkundungen des DGB blicken 70% der HochschulabsolventInnen optimistisch nach vorne; eine Befragung der „AG Hochschulforschung“ aus dem Jahre 2007 hingegen zeigt, dass 65% der Befragten ihre Aufstiegschancen als schlecht ansehen. Die Realität sieht – auch unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklung? – deutlich besser aus: Neun Monate nach dem ersten Praktikum haben nur 4% der Uni-Absolventen keinen (angemessenen?, W. Sp.) Job; 10 Jahre nach dem Abschluss liegt die Arbeitslosenquote dieses Segments bei nur einem Prozent. (vgl. dazu DIE ZEIT. 2009. Nr. 18, S. 63 und 67)