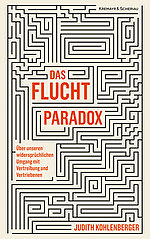Die Vorstellung, dass Migrant:innen, erst im Migrationsland angekommen, ausschließlich dort von ihrer Umwelt beeinflusst werden und diese reziprok auch beeinflussen, greift schon lange zu kurz, wie Christina Schachtner in Global Age, Migration und Medien. Transnationales Leben herausarbeitet. Die Autorin ist Professorin an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und forscht unter anderem zu Medien, Migration und Narrationen im digitalen Zeitalter. Im Zuge ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema griff sie vor allem auf Erzählungen von Migrant:innen zurück: „Das Forschungsinteresse richtete sich in der Studie ‚Transnational leben‘ auf Bedeutungen und Sinn, die/den Migrant*innen mit ihrem Denken, Handeln und Fühlen explizit oder implizit verbinden.“ (S. 15)
Transnationalität als verborgene Seite der Moderne
Zunächst bedarf es jedoch einer ausführlichen Auseinandersetzung mit den im Titel enthaltenen Begriffen. Global Age beziehe sich den Arbeiten von Martin Albrow zufolge auf die globale Gesellschaftsform, womit der Begriff der Globalisierung als Mittel der Transformation „in die zweite Reihe“ (S. 30) verwiesen wird. Im Zuge der Entwicklung hin zum Global Age wurde, wieder mit Verweis auf Albrow, eine „verborgene Seite der Moderne“ sichtbar: das Transnationale. „Transnationale soziokulturelle Räume entfalten sich quer zu Nationalgesellschaften (Pries 1998, 77). Es sind Räume, für die ein Hier-wie-Dort und ein Sowohl-als-Auch gilt (Nassehi 2003, 75).“ (S. 34)
In der Arbeit mit dem Konzept der transnationalen Räume beziehungsweise eben Transmigration tritt ein relativ neues Interesse innerhalb der Migrationsforschung zu Tage: Forscher:innen betrachten auch Alltagspraktiken, wie soziale Anpassung, Vielsprachigkeit und weitere Fähigkeiten, welche Menschen mit Migrationsgeschichte im Migrationsland erlernen müssen. Transmigrant:innen haben ihren Bezugsrahmen in mehr als einem Ort und identifizieren sich mit mehr als einer Kultur. Sie erweitern ihr soziokulturelles Kapital und stehen dabei auch vor der Herausforderung, dass bestimmte erlernte Verhaltensweisen im Migrationsland nicht mehr gelten. Eine Interviewpartnerin beschreibt dies als „Mischmasch“ (S. 244). Der Umgang damit variiert jedoch zwischen den Persönlichkeiten: Während eine junge Dame sich ganz klar von den strengen Erwartungen an Frauen im Herkunftsland abgrenzt und sich im Migrationsland für Frauenrechte einsetzt, beschreibt ein anderer, wie sehr es ihn störe, „dass etwas deutsch in mir steckt“, wenn er plötzlich in Mosambik über die laute Musik der Nachbarn zu meckern beginnt. (S. 224)
Einfluss unterschiedlicher Kommunikationsformen
Die voranschreitende Mediatisierung nimmt wesentlichen Einfluss auf das transnationale Dasein der Migrant:innen, während diese dem Buch zufolge zeitgleich einen nicht unbedeutenden Einfluss auf den Mediatisierungsschub nehmen. Insbesondere skopische Medien, also jene Kommunikationsmittel, welche virtuellen face-to-face Austausch ermöglichen, seien für Transmigrant:innen relevant. Diese Kommunikationsform ermöglicht die „Verknüpfung unterschiedlicher Zeit- und Raumzonen“ (S. 62). Die gesellschaftliche Makroebene bleibt davon nicht gänzlich unbeeinflusst, konstatiert Schachtner, indem sie darauf verweist, dass „sich durch dieses Handeln im Zeichen des Skopischen soziale Interaktionsformen“ verändern. (S. 65)
Rolle von Städten
Abschließend nimmt die Professorin Ankunftsländer und Städte mehr in die Pflicht, indem sie darauf verweist, dass die bisherigen migrationssensiblen Veränderungen in Städten primär den Ideen und Zielen von Migrant:innen selbst entsprungen sind. Unter Rückgriff auf Mark Terkessidis benötige es darüber hinaus aber politische Ambitionen, um eine Stadtplanung zu ermöglichen, welche die Partizipation und Begegnung aller Gruppen in den Mittelpunkt stellt. Insbesondere im Musikalischen zeigt sich etwa das Potential offener Gesellschaften: Clubs orientieren sich zunehmend an diversen internationalen Trends und Lifestyles, sodass man diese als ethisch eben nicht mehr vorstrukturierten Räume bezeichnen kann.
Mit Blick auf künftige Entwicklungen brauche es der Autorin zufolge eine Ethik der Toleranz, um auftretende Widersprüche akzeptieren zu können. Hierfür ist es eine „translationale Mehrsprachigkeit“ notwendig, welche das Denken abseits klarer Grenzen in Zwischenräumen ermöglicht.