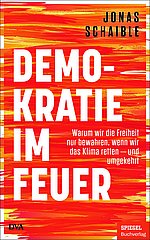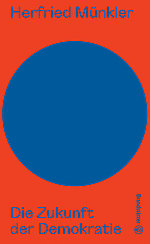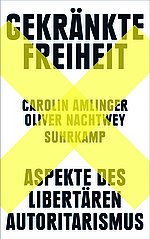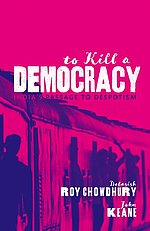Etwas fehlt. Aus dem öffentlichen Diskurs der letzten Jahre über die Krise der westlichen Demokratie hat sich das Thema „direkte Demokratie“ still und leise verabschiedet. Dabei wird in Umfragen zur Qualität der Demokratie – wie etwa zuletzt im SORA-Demokratiemonitor – ständig mehr politische Beteiligung eingefordert, und zwar wirksame. Die emeritierte Professorin für Öffentliches Recht der Universität Bielefeld und ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts Gertrude Lübbe-Wolff macht dies zu Beginn ihres neuen Buches an den Veränderungen der deutschen Parteiprogramme in den letzten Jahren und dem aktuellen Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung fest.
„Neue Angst vor dem Bürger als Entscheider“ durch Brexit und Trump
Das Brexit-Votum von 2016, die Wahl Donald Trumps und die Abstimmungserfolge der europäischen Rechtspopulist:innen hätten die Angst vor dem populistischen Missbrauch von direkten Abstimmungen über Sachfragen befeuert. Lübbe-Wolff will daher mit zehn gängigen Vorbehalten gegen Instrumente der direkten Demokratie aufräumen, Vorbehalten, die aus dem politischen Diskurs durchwegs bekannt sind, ihren Weg dorthin aber oftmals – unter deutlicher Komplexitätsreduktion – aus der Wissenschaft gefunden haben. Die Vorbehalte betreffen zum einen die Urteilsfähigkeit der Wahlberechtigten, etwa, dass Bürger:innen für die Entscheidung von Sachfragen zu dumm seien, leichte Beute für Demagog:innen oder verantwortungslos, zum anderen angebliche Verfahrensschwächen wie die Unmöglichkeit von Kompromissbildungen bei Ja-Nein-Fragen, mangelnde Alternativen oder fehlende Übernahme von Verantwortung für das Ergebnis.
Durch die rigorose Analyse eines beachtlichen Literaturkörpers und der verfügbaren Empirie, allein das Literaturverzeichnis ist über 45 Seiten lang, weist Lübbe-Wolff bei allen Vorbehalten zwei Fehler nach. Der Idealvergleichsfehler bestehe darin, direkte Demokratie mit einem unrealistischen Ideal zu vergleichen, und nicht mit dem in vielen Punkten viel mangelhafteren Repräsentativsystem. Hier wie dort sei es nicht zuletzt eine Frage der Mechanismen und des Prozessdesigns, ob sachlich begründete Entscheidungen herauskommen. Dies gilt in einem anderen Zusammenhang auch für den Pauschalisierungsfehler, der Mängel eines bestimmten Verfahrens der direkten Demokratie auf alle ihre Formen verallgemeinere. Exemplarisch veranschaulicht Lübbe-Wolff dies anhand der Brexit-Abstimmung. Per Anlassgesetzgebung durch das Parlament angeordnet sei ein Austritt aus der EU ohne Kenntnis der Austrittsbedingungen zur Abstimmung gestellt worden. „Den Bürgern einen EU-Austritt ohne jede Präzisierung der angestrebten Variante und ohne eine Perspektive der Neuentscheidung bei Vorliegen des Ergebnisses der Austrittsverhandlungen zur Abstimmung vorzulegen, gehört zu den Irrationalitäten, die vor allem dann zu erwarten sind, wenn repräsentativdemokratische Politik ‚von oben‘ über den Einsatz des Instruments der Volksabstimmung verfügt“ (S. 56). Weder vorher noch nach dem Referendum habe es für einen Austritt zu den letztlich ausverhandelten Bedingungen im Vereinigten Königreich eine Mehrheit gegeben. Des Weiteren würde ein Ergebnis, das vor dem Hintergrund nachweislicher Falschinformationskampagnen entstanden ist, etwa in der Schweiz gerichtlich aufgehoben werden.
(Höchst-)Gerichte als wichtige Qualitätssicherung
Lübbe-Wolff lenkt den Blick weg vom Ob auf das Wie direkter Demokratie und öffnet damit eine faszinierende – und im Detail komplexe – Welt des Mechanism Designs. So weist Lübbe-Wolff nicht nur anhand des Brexit-Debakels sondern zahlreicher anderer Schwächen direktdemokratischen Entscheidens nach, dass das Initiativrecht bei der Regierungsmehrheit schlecht aufgehoben ist. Zu groß sei die Gefahr demagogischen oder autoritaristischen Missbrauchs, die Vermischung mit Personalfragen oder mit der Zufriedenheit des generellen Regierungskurses sei kaum vermeidbar und die Kraft zum Kompromiss und zur parlamentarischen Aufnahme eines genuin aus der Bevölkerung kommenden Anliegens bleibe ungenützt. Die Vorteile direktdemokratischen Entscheidens ließen sich am besten durch ein Volksinitiativrecht, bestenfalls ergänzt durch ein parlamentarisches Oppositionsrecht oder gesetzliche Pflichtabstimmungen in bestimmten Fällen, verwirklichen.
Die Wichtigkeit der richtigen Ausgestaltung zeige sich etwa auch bei der unterliegenden politischen Kultur, etwa, wenn Lübbe-Wolff darauf hinweist, dass das konkordanzdemokratische System in der Schweiz mit seiner korporatistischen Prägung die Integration von direktdemokratischen Instrumenten in ein System repräsentativer Politikgestaltung erheblich erleichtert – im Gegensatz etwa zur US-amerikanischen Konkurrenzdemokratie. Dies ist gerade im österreichischen Kontext ein wertvoller Hinweis für zukünftige Reformvorschläge.
Schließlich spiele die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung von Volksabstimmungen, etwa bei der Entscheidung über grundrechtsrelevante Gesetze, eine wichtige Rolle. Es stelle sich am Schluss also weniger die Frage, wer es besser kann, das Parlament oder die stimmberechtigte Bevölkerung, sondern wie diese beiden Formen demokratischen Entscheidens in eine sinnvolle Symbiose gebracht werden könnten.
Nicht immer kann die Argumentation vollständig überzeugen, etwa wenn Lübbe-Wolff den Vorwurf der Rechtslastigkeit der erfolgreichen Schweizer Volksinitiativen zum Minarettverbot und zur „Masseneinwanderung“ entkräften möchte, indem sie auf die anschließende Mäßigung durch Parlament und Rechtsprechung verweist. Dieser Verweis zur Durchsetzung eines grund- und menschenrechtlichen Schutzes als eben notwendiges Ausgestaltungsmerkmal vermag hier nicht wirklich zu beruhigen.
Gegen die Kurzfristorientierung repräsentativdemokratischer Politik
Bei dem etwas kurz geratenen Teil über die vernachlässigten Argumente für direkte Demokratie sticht vor allem die Möglichkeit heraus, ein Gegengewicht gegen die Kurzfristorientierung repräsentativdemokratischer Politik schaffen zu können. Lübbe-Wolff stößt mit ihrem Beitrag eine wichtige und längst fällige Diskussion neu an und erinnert daran, dass Demokratie nicht einfach so entsteht, sondern nur dadurch, dass sie geübt wird.