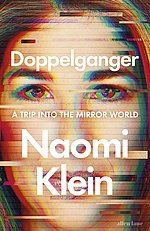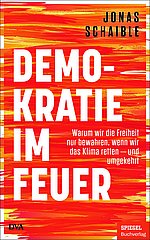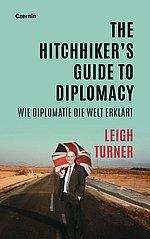
Leigh Turner war Botschafter in der Ukraine und in Österreich und fasst hier seine 42-jährige Dienstzeit (1979 bis 2021) für das Vereinigte Königreich zusammen. Das Buch bietet Einblick in eine Welt, die viele Bürger:innen nie zu Gesicht bekommen. Was passiert in den Villen der Diplomat:innen, wie laufen Konferenzen ab? Turner liefert diese Einblicke und wir treffen nicht auf eiskalte Floskelmaschinen, sondern auf Menschen, die die unterschiedlichsten Interessen ihrer Staaten unterstützen wollen. Und sie tun dies auch dann, wenn sich diese Interessen gar nicht mit den eigenen Vorstellungen einer guten Entwicklung zur Gänze decken. Ja, Turner war britischer Botschafter (in Wien), als der Brexit vollzogen wurde. Neben diesen Einblicken ist besonders interessant, welche Entwicklungen in der Diplomatie Turner beobachtete. Die Diplomatie ist seit Jahrhunderten im Wandel begriffen. Mit wechselndem Schwerpunkt wird gefragt: „Wer braucht schon Diplomaten, wenn es Telegramme/Fernsehen/das Internet gibt?“ Die erste Stellenbeschreibung Turners enthielt (1983) noch das „Überwachen der Speicherung und Aktualisierung von Dokumenten im Abteilungscomputer“. Dies sei binnen gut 20 Jahren von einem regelrechten „E-Mail-Chaos“ abgelöst worden. „Den Mitarbeitern bleibt neben der Bearbeitung des E-Mail-Verkehrs – der Großteil damals wie heute irrelevant – und Sitzungen wenig Zeit für anderes“. Für Turner steckt dahinter die genutzte neue Möglichkeit, „alle zu konsultieren, die davon betroffen sein könnten, – egal wie viele es sind oder ob sie nur am Rande davon berührt sind“. Das führte zu einem Kulturwandel: „Niemand war in der Lage, Eigenverantwortung für politische Maßnahmen zu übernehmen, wodurch die Entscheidungen schlechter wurden“ (je S. 285). Diese Verhaltensänderung wurde begleitet von der Dezentralisierung diplomatischer Kontakte. „Heute kann sich jeder Beamte in Whitehall über sein Smartphone auf globale verschlüsselte Videokonferenzen zuschalten. Ihre Amtskollegen auf der ganzen Welt sprechen oft Englisch mit britischem oder amerikanischem Akzent“ (S. 419). Für Turner ändert das aber nichts am Bedarf an Fachwissen über ferne Länder, die Bevölkerung und Politik, das man am besten vor Ort erwirbt, wie die Geschichten in diesem Buch erzählen.