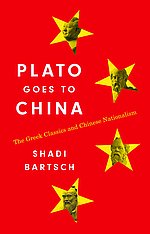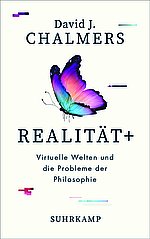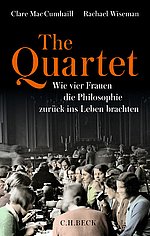Konflikte sind allgegenwärtig. Sie treten zwischen einzelnen Menschen auf, im Arbeitsalltag, in Beziehungen, zwischen Organisationen und sozialen wie politischen Gruppen, zwischen Staaten und Staatengruppen. Doch was unterscheidet einen Konflikt eigentlich von benachbarten Begriffen wie Streit, Auseinandersetzung, Konfrontation, Kampf oder gar Krieg? Genau besehen ist es alles andere als klar, was ein Konflikt ist und was ihn auszeichnet. Der Philosoph und politische Theoretiker Armen Avanessian, Professor für Medientheorie an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, bemüht sich nun um eine begriffliche und theoretische Klärung. Und kommt dabei zu überraschenden Einsichten, die quer liegen zu dem gewohnten Begriffsgebrauch und -verständnis.
Er sagt: Entgegen der üblichen Ansicht, die Konflikte in der Gegenwart verortet oder aus der Vergangenheit ableitet, „sind diese immer erst herzustellen und liegen somit in der Zukunft“ (S. 22). Konflikte lassen sich auch nicht auflösen, denn sie gehören zu dem Kontext, in dem sie auftreten. Sie sind essenzieller Teil einer Person oder Gesellschaft. Und sie sind auch keine Gefahr, sondern – richtig verstanden – Ansatz zur Lösung der dahinter liegenden Probleme. Konflikte, wie sie mit Klimawandel, Umweltveränderungen und Digitalisierung verbunden sind, machten eine fundamentale Einsicht deutlich, so Avanessian: „Konflikte kommen aus der Zukunft auf uns zu. Darum müssen wir sie auch von der Zukunft her verstehen“ (S. 25). Und verstehen heißt herstellen. Herstellen von Konflikten bedeute, „ihre immer erst zukünftige Form schon heute präsent zu machen“ (S. 274). Gleiches gilt für die Subjekte dieser Konflikte. Erforderlich sei, ein nicht nur globales, sondern „ein tatsächlich planetarisches kollektives politisches Subjekt herzustellen“ (S. 320), das der Ausweitung der Konfliktzonen im Anthropozän gerecht werde. Das bedingt zweierlei: eine Erweiterung der Menschenrechte um Klima- und Umweltrechte und die Einbeziehung zukünftiger Generationen. Nicht zuletzt brauche es neue verbindliche Institutionen auf planetarischer Ebene. Wir müssten „die Herstellung des Planetarischen als den zentralen politischen Zukunftskonflikt verstehen“ (S. 338), so die Schlussfolgerung des Autors. Sein Plädoyer: Es gelte, die Probleme von morgen schon heute zu lösen – „denn wenn wir das erst in der Zukunft versuchen, wird es höchstwahrscheinlich zu spät sein“ (S. 23).