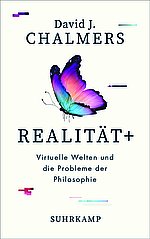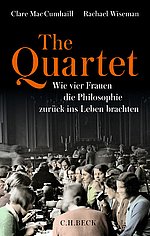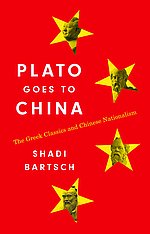
Eine auf den ersten Blick uneinsehbare Kombination liefert Shadi Bartsch mit diesem jüngst erschienen Band. Die Professorin für Klassische Philologie an der Universität Chicago geht darin folgender Frage nach: Welche Rolle spielt die griechische Antike im kontemporären politischen Diskurs der Volksrepublik China? Bartsch analysiert vor zweierlei Prämissen: 1. Der chinesische öffentliche und akademische Diskurs beschäftigt sich intensiv und breit mit den Gedanken griechischer Schriftsteller wie Platon, Thukydides oder Aristoteles; 2. Der Umgang Chinas mit diesen Texten ist für unser eigenes (wie auch immer als westlich verstandenes) politisches, soziales und kulturelles Selbstverständnis von Bedeutung.
Der Westen in China
Aus historischer Perspektive ist die erste Prämisse nachvollziehbar und vertretbar. Nach dem Fall der Qing Dynastie und der Ausrufung der Republik im Jahr 1912 beschäftigte man sich verstärkt mit westlichen Texten, darunter auch klassisch antiken, auf der Suche nach Antworten zu Fragen wissenschaftlicher und politischer Neuorientierung und Entwicklung. Bartsch arbeitet durchgehend schlüssig und mit beneidenswerter Kenntnis griechischer, englischer und chinesischer Quellen heraus, dass der fundamentale Unterschied zwischen der Beschäftigung mit der Antike vor über hundert Jahren und in der Gegenwart in unterschiedlichen Sichtweisen manifestiert liegt: Während man in der frühen Republik die antiken Denker als kontrastive Inspiration und relevant für die Entwicklung einer postfeudalen Gesellschaft ansah, werden sie heute bald als Anlass für Kritik am (besonders amerikanischen und europäischen) Westen, bald als Legitimation für die politischen Dynamiken der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gelesen. Pointiert und typisch für ihre immer engagierte Schreibweise stellt Bartsch fest, dass chinesische öffentliche Intellektuelle, Blogger:innen und Journalist:innen damit einen scheinbar kuriosen Weg einschlagen: man stelle sich vor, die demokratische Partei in den USA würde das „Buch der Riten“ herbeiziehen, um sowohl den Herrschaftsanspruch der KPCh zu untergraben als auch die eigene politische Agenda zu rechtfertigen. Verstärkt wird diese eigenartige Dynamik durch den Blick auf die Rolle der antiken Sprachen und Kultur im rezenten westlichen Diskurs. Dort werden antike Texte entweder als zu überwindende Artefakte einer Kultur abgetan, die sowohl das Patriarchat als auch den Imperialismus legitimieren, oder sie werden in utilitaristischer Manier als nutzlos für die Bedürfnisse, Herausforderungen und Probleme des frühen 21. Jahrhunderts betrachtet, wenn nicht gar als dekadente Spielerei abgekanzelt. Forschungspolitisch stehen dementsprechend Departments, Institute und Lehrstühle in Europa und Amerika unter ökonomischem und kulturellem Existenzdruck. Anders in China, wo die alten Sprachen in mannigfaltigen institutionellen Manifestationen in den letzten Jahren florieren. Einer der zentralen Kulminationspunkte dieses neuen Interesses liegt in der Forscherpersönlichkeit Liu Xiaofeng, der im Programm einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift an exponierter Stelle konstatiert: Will China sich selbst verstehen, muss es zunächst den Westen verstehen. Will es den Westen verstehen, muss es zunächst die griechische Antike verstehen.
China im Westen
In einem zweiten Schritt verweist Bartsch auf die Chance, dass durch die Analyse der chinesischen Rezeption der griechischen Antike eine gewinnbringende Spiegelperspektive auf westlicher Seite eingenommen werden kann. Bei der Lektüre klassischer Texte werden die Idee der Demokratie als ideale Regierungsform, die Philosophie als rationale Operation und Bürger:innen als universelle politische Bezugsnorm oft unhinterfragt (und in einem argumentativen Zirkelschluss) als normative Grundlagen betrachtet. Diese unbefriedigende Situation kann durch eine Lesepraxis von außen durchbrochen werden. Zuletzt verweist Bartsch auf die reziprok gesteigerte Einsicht in chinesische politische Praktiken. Der wechselnde Blick, mit dem China die antiken Texte rezipiert, adaptiert und appliziert, offeriert eine exemplarische Sichtweise auf ein China, welches sich in gesteigertem Maße als neuer Herausforderer der USA in Sachen globalpolitischer Führungsanspruch und kultureller Hegemonie sieht.
So arbeitet sich Bartsch stets elegant lesbar von der Auseinandersetzung mit den Jesuiten in der Frühneuzeit bis hin zur rezenten Rezeption der Platonlektüre Leo Strauss’ vor. Dabei geht es zwar immer wieder nicht ohne Vorwissen vonstatten, dennoch und gerade deshalb sei das Buch mit größtem Nachdruck allen empfohlen, die sich entweder mit der Rezeption der westlichen Antike im globalen Kontext oder mit rezenten politischen Diskursen Chinas beschäftigen wollen. Die kleine Zahl derjenigen, die sich auf der Schnittstelle bewegen, werden das Buch nicht aus der Hand legen können.