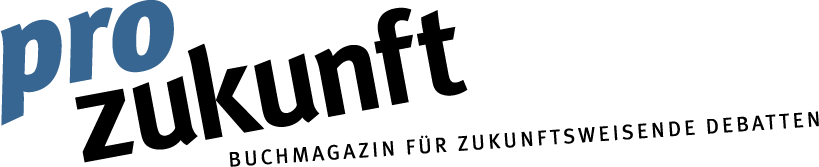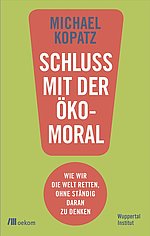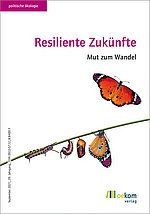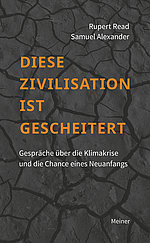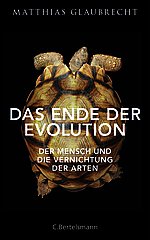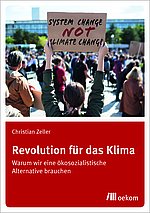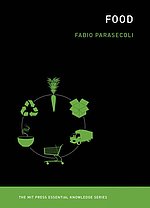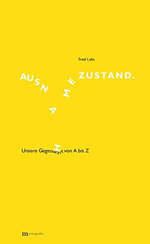Die drohende Klimaerwärmung ist das zentrale globale Umweltproblem der Gegenwart, was spätestens seit der Konferenz von Rio wohl unbestritten ist. Nun ist es die Stärke des Worldwatch Instituts, die Aufmerksamkeit auch auf andere, weniger beachtete Weltprobleme zu lenken, was auch die nunmehr 13. Ausgabe von Zur Lage der Welt eindrucksvoll belegt. So verweist Lester Brown, der Präsident des Instituts, in seinem einleitenden Beitrag auf die weitgehend verdrängte, sich zuspitzende Nahrungsmittelknappheit, die aus der immer größer werdenden Kluft zwischen Bevölkerungswachstum und nicht weiter steigerbarer Ausbeutung der Erde resultiere. Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise sowohl bei Getreide wie bei Fisch - so Brown - sei der sensibelste wirtschaftliche Indikator für politische Krisen, Fischereikriege wie Hungersnöte die Vorboten neuer Umweltkonflikte, die die nächsten Jahrzehnte bestimmen würden. Die Hauptanstrengung für eine zukunftsfähige Entwicklung der Erde sieht Brown in der Stabilisierung des Bevölkerungswachstums, die bislang erst ein Siebentel der Menschheit erreicht habe. Sandra Poste I benennt mit der zunehmenden Verknappung der Ressource Wasser einen weiteren Umweltkonflikt der Zukunft, der nicht nur Spannungen zwischen Anrainerstaaten großer Flüsse, sondern auch zwischen Stadt- und Landbevölkerungen erzeugt, ein Umstand, der durch die rasante Verstädterung - die Zahl der in Städten lebenden Menschen wird sich bis zum Jahr 2025 vermutlich verdoppeln und auf fünf Milliarden anwachsen - an Brisanz gewinnt. Bislang zu wenig Beachtung finden wohl die Themen weiterer Beiträge des Bandes: Gary Gardener warnt vor dem weltweiten Ausverkauf landwirtschaftlicher Nutzfläche durch Urbanisierung und Industrialisierung, Chris Bright schildert die Gefahren sogenannter “Bioinvasionen ", der unkontrollierten Ausbreitung exotischer, Biohaushalte zerstörender Pflanzen- und Tierarten. Anne E. Platt skizziert schließlich das virulente Problem der Verbreitung von Infektionskrankheiten. Doch auch Positivbeispiele werden dargelegt. So entwirft Hai Kane ein Zukunftsszenario für die Umstellung auf nachhaltige Industrien, die etwa im Bereich des Eisen- und Stahlrecyclings in den USA bereits weit gediehen ist. Aaron Sachs verweist auf die Gemeinsamkeiten von Umwelt- und Menschenrechtsanliegen und erste erfolgreiche Beispiele der Kooperation von NGOs beider Bereiche. Nicht zuletzt bestärkt David Malin Roodmann in seinen abschließenden Ausführungen den Ansatz, Marktmechanismen für den Umweltschutz zu nutzen, wobei er insbesondere europäische Staaten wie Dänemark oder die Niederlande als Pioniere ökologischer Steuersysteme hervorhebt. Bei aller Anerkennung, die den warnenden wie Zukunftswege aufzeigenden Berichten dieses Bandes gebührt, ist auch eine kritische Anmerkung anzubringen: nämlich die - von Ausnahmen abgesehen - auffallende Zurückhaltung in der Kritik am ressourcenverschlingenden Lebensstil der Industriestaaten des Nordens. H. H.
Zur Lage der Welt 1996. Konzepte für das Überleben unseres Planeten. Hrsg. v. Worldwatch Institute. Frankfurt1M.: Fischer, 1996. 335 S.