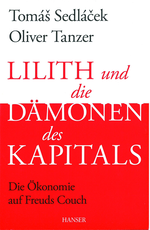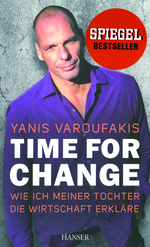Erfrischend wirkt ein Buch des österreichischen Ökonomen Markus Marterbauer mit dem provokanten Titel „Zahlen bitte!“. Marterbauer gibt nicht nur dem Mainstream widersprechende Antworten auf komplexe Fragen, sondern er deckt auch – untermauert mit zahlreichen Fakten – etwa Warnungen vor einem überbordenden Sozialstaat, einer drohenden großen Inflation oder gar einem Kollaps der Staatsfinanzen als interessengeleitete Mythen auf. Doch der Reihe nach.
Gleich zu Beginn formuliert der Ökonom seine zentralen Vorschläge für eine zukunftsweisende (europäische) Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Neben der Verschuldungskrise müsse auch die Arbeitslosigkeit insbesondere der jüngeren Generation in immer mehr EU-Staaten als Problem wahrgenommen werden. So übersteige in Griechenland, Irland und den baltischen Ländern die Arbeitslosenquote der 15-24-Jährigen bereits die Marke von 30 Prozent der Erwerbspersonen deutlich, in Spanien sei mittlerweile nahezu jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Das birgt sozialen Sprengstoff. Marterbauers zentrale These lautet daher, dass mittelfristig „nur eine wirtschaftliche Erholung, begleitet von einem merklichen Rückgang der Arbeitslosigkeit, und eine aktive Verteilungspolitik gegenüber den großen privaten Vermögensbeständen die ökonomische Basis für eine Verringerung der Staatsschulden bilden“ könne (S. 12). Das von der EU diktierte „griechische Sparpaket“ betrachtet der Ökonom daher kritisch (s. u.).
Bankensektor verkleinern
Zum Grundsätzlichen. Wie andere auch kritisiert Marterbauer die Verselbständigung des Finanzsektors als zentrale Ursache für die globale Finanzkrise. So erscheine es paradox, „dass Finanz-innovationen, die ursprünglich zur Verringerung des Risikos einzelner Finanzgeschäfte geschaffen wurden, selbst enorme Risiken erzeugt haben und schließlich 2007 und 2008 nahezu den Zusammenbruch des gesamten weltweiten Finanzsystems bewirkt haben.“ (S. 36)
Nur die weltweit gerechtere Verteilung des Wohlstands könne nachhaltige Wege aus der Krise weisen, ist Marterbauer überzeugt. Er sieht dafür zwei Strategien – die „Beendigung der Privatisierung von öffentlichem Eigentum“ sowie die „Erhöhung der Besteuerung von Vermögensbesitz“ (S. 52) – und verweist zugleich darauf, dass dies nicht ohne Konflikte abgehen werde. Denn: „Umverteilung tangiert die Interessen der Mächtigen und muss von den Ohnmächtigen eingeklagt werden. Umverteilungspolitik muss sich nicht nur gegen die einflussreichen Besitzer großer Finanz- und Immobilienvermögen stellen, sondern auch den Widerstand jener mächtigen Institutionen überwinden, die wie Banken oder Steuerberater von der Betreuung der Vermögenden profitieren. Beide Gruppen haben großen Einfluss auf Medien und die öffentliche Meinung.“ (S. 51f.)
Doch die Potenziale sind groß: „Schon eine effektive Besteuerung von Vermögen mit einem Steuersatz von nur 0,5 Prozent würde in Österreich Staatseinnahmen von 6 bis 7 Milliarden Euro und in der EU von etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr mit sich bringen“ (S. 52), berichtet der Ökonom. Eine Bankenabgabe in der Höhe von 0,2 Prozent der Bilanzsumme aller im Euro-Raum aktiven Banken würde „ein jährliches Volumen von etwa 50 Milliarden Euro“ (S. 74) ergeben und eine Verkleinerung des Bankensektors sowie dessen Gewinnmargen begünstigen, so Marterbauer weiter. Das Bankengeschäft müsste so wie in den 1950er und 1960er Jahren wieder auf die Interessen der realen Wirtschaft, also der privaten Haushalte und der investierenden Unternehmen ausgerichtet werden. Denn: „Nach Erfahrungen in der Finanzkrise ist fraglich, ob in Teilen des Finanzsektors überhaupt volkswirtschaftliche Werte geschaffen werden.“ (S. 60) Durch die Bankenrettungspakete werde jedoch die „langfristig wünschenswerte Schrumpfung des Finanzsektors durch die Insolvenz wirtschaftlich nicht erfolgreicher Institute vermieden.“ (S. 80)
Soziale Dienste ausbauen
Die Exportorientierung von Ländern wie Österreich oder Deutschland sieht Marterbauer als wichtige Stützen der Wirtschaft (der Exportanteil Österreichs lag 2010 bei 55 Prozent des BIP). Produktivitätszuwächse in der Sachgütererzeugung (in Österreich Steigerung um 60 Prozent von 1995 – 2011) würden gemeinsam mit der stärkeren Heranziehung der Vermögen einen Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen. Pro Milliarde an Staatsausgaben steige die Zahl der Jobs um 18. 000 bis 25.000, rechnet der Ökonom vor und verweist auf die hohen Beschäftigungswirkungen öffentlicher Investitionen: „6.000 bis 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze pro Milliarde Euro“. Gering sei jedoch das Arbeitsplatzpotenzial von Steuerentlastungen. Pro Milliarde Steuerentlastung entstehen laut Marterbauer „nur 2000 bis 5000 zusätzliche Arbeitsplätze.“ (S. 140) Nichts hält der Ökonom von generellen Steuersenkungen sowie Steuerbegünstigungen, die immer die Besserverdienenden bevorzugten. „Vor allem von der in der Politik so beliebten Senkung der Einkommenssteuern profitiert primär das Haushaltsdrittel mit dem höchsten Einkommen.“ (S. 139f.)
Zudem schlägt Marterbauer die Kaufkraftstärkung der Haushalte mit niedrigen Einkommen vor, da nur diese den Konsum ankurbeln. „In Österreich steigert ein Zusatzeinkommen in der Höhe von 100 Euro beim unteren Drittel der privaten Haushalte die Konsumnachfrage sofort um 80 Euro. Das obere Einkommensdrittel hingegen erhöht das Sparen um 60 Prozent.“ (S. 64) Insgesamt müssten Länder mit hohem Exportanteil auch die Importe steigern, weil ansonsten Defizitländer wie Griechenland es nie schaffen würden, ihre Leistungsbilanz zu verbessern.
„Die Staatsschuldenkrise ist in erheblichem Ausmaß eine sich selbst erfüllende Prophezeiung der vom Herdentrieb geprägten spekulativen Finanzmärkte“ (S. 10), so Marterbauer pointiert. Auch wenn die Defizite von EU-Staaten unterschiedlich hoch und auch unterschiedlich gewichtet seien und es daher kein Patentrezept geben könne, sei klar: „Die Staatsfinanzierung der Krisenländer, aber auch der anderen EU-Länder, muss von den Finanzmärkten und ihrer spekulativen Ausrichtung entkoppelt werden.“ Diesem Zweck diene die Schaffung des ESFS, „der sich deutlich günstiger verschulden kann als die meisten Mitgliedsländer, allerdings müsste das Volumen der Verschuldungsmöglichkeit erhöht werden. Den gleichen Effekt hätte die vieldiskutierte Ausgabe von Eurobonds, also einer gemeinsamen Anleihe der EU-Länder“ (S. 94) – ein Vorschlag, der nun ja vom neuen französischen Präsidenten Francois Hollande erneut ins Gespräch gebracht wurde. Die bisherige Praxis der EZB hält Marterbauer für problematisch: „Die Banken erhalten von der EZB Liquidität zu einem Zinssatz von gut einem Prozent, sie legen diese Mittel in Staatsanleihen mit Zinssätzen zwischen 4 und 15 Prozent an. Das ist eine ungeheure staatliche Subvention für die Banken.“ (S. 94)
Und aktuell zu Griechenland: Dass es gefährlich sei, den Sündern aus dem Süden zu helfen, da so falsches Verhalten belohnt und richtiges bestraft werde, hält Marterbauer für ein Vorurteil und für Stimmungsmache, die die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge übersehe: „Erlegt man den Krisenländern harte Sanierungsmaßnahmen auf, unter denen Menschen und Wirtschaft leiden, so tut man sich selbst nichts Gutes. Die Maßnahmen führen zu einem Rückgang des BIP, damit des Imports in Krisenländer und schwächen den Export und das Volkseinkommen der Handelspartner.“ (S. 93)
Ähnlich argumentiert Marterbauer gegen die Angst vor einer Hyperinflation, die vor allem von Vermögensbesitzern geschürt werde. Diese drohe nur bei einer Überhitzung der Wirtschaft – stark steigende Nachfrage und sich aufschaukelnde Lohn-Preis-Spirale – beides sei aber nicht gegeben. Gefährlicher als Inflation sei ein Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten: „Die großen Krisen der Weltwirtschaft, wie jene in den 1930er-Jahren, waren immer Deflationskrisen und nicht Inflationskrisen.“ (S. 121) Auch im kolportierten Versuch, Staatsschulden durch Geldabwertung zu verringern, sieht der Ökonom kein taugliches Mittel. Vielmehr biete sich hier eine merkliche Erhöhung der Vermögenssteuern an: „Sie hat ähnliche positive Effekte wie Inflation, indem sie den Schuldner Staat entlastet und die Gläubiger, die Besitzer der Finanzvermögen belastet. Gleichzeitig weist sie jene Nachteile nicht auf, die eine anhaltende und hohe Inflation mit sich bringen kann.“ (S. 128) Für denkbar hält Marterbauer eine „Vermögenspreisinflation“, allerdings bedingt durch eine Überbewertung von Immobilien oder Aktien, die jedoch zu Recht nicht in den Verbraucherpreisindex eingerechnet werde.
Wirtschaftswachstum neu
Abschließend wendet sich Marterbauer der Frage zu, wie Wohlstand und Sozialstaat auch mit bedeutend geringeren Wachstumsraten gesichert werden können. Wirtschaftswachstum führe zwar zu einer Verringerung der Arbeitslosigkeit, reiche aber nicht mehr aus, „um Vollbeschäftigung zu erreichen.“ (S. 222) Zukunftswege sieht der Ökonom in neuen Arbeitszeitmodellen, die Erwerbsarbeit und Beruf für beide Geschlechter vereinbar machen – Produktivitätsfortschritte würden somit verstärkt in Form von mehr Zeit weitergegeben –, in einer aktiven Lohn- und Bildungspolitik sowie eben in einer neuen Finanzierungsbasis für den Staat. Denn: „Eine Verschiebung der Abgabenstruktur von den Arbeitseinkommen zu den Vermögensbeständen und –einkommen würde die Finanzierung des Staatshaushalts unabhängiger von Wirtschaftswachstum und Lohnanteil am BIP machen.“ (S. 225)
Resümee: Die Frage, wer die Kosten der Krise zahlt und wie solche Krisen in Zukunft verhindert werden können, ist entscheidend für den demokratischen Zusammenhalt auch der Gesellschaften Europas. Markus Marterbauer zeigt konkrete Wege und vorhandene Verteilungsspielräume auf, wie ein nachhaltiges Wirtschaften sowie eine Gesellschaft, der soziale Sicherung wichtig ist, miteinander verbunden werden können. H. H.
Marterbauer, Markus: Zahlen bitte! Die Kosten der Krise tragen wir alle. Wien: Deuticke, 2011. 252 S., € 17,90 [D], 18,40 [A], sFr 25,10
ISBN 978-3-552-06173-6