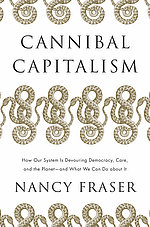Als der Ökonom Joseph A. Schumpeter Anfang der 1940er-Jahre den Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ in die Wirtschaftswissenschaften einführte, war dies ein Affront gegen die herrschende ökonomische Lehre. Denn von Innovation war dort damals nicht die Rede, und was sich dahinter verbirgt, noch kaum verstanden. Schumpeter machte nun deutlich: Innovation ist der Schlüssel zu wirtschaftlichem Fortschritt, und „der Prozess der ‚schöpferischen Zerstörung‘ ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum“. Mit weitreichender Wirkung. Innovation gilt seither als die maßgebliche Triebkraft wirtschaftlicher Entwicklung.
Statt von schöpferischer Zerstörung spricht man heute meist von Disruption, ein Begriff, der von dem Ökonomen Clayton M. Christensen geprägt wurde. Disruptive Technologien sind ihm zufolge bahnbrechende technologische Veränderungen, die die Erfolgsserie einer bestehenden Technologie unterbrechen und diese vom Markt verdrängen. Christensen unterschied damit zwischen Innovationen, die lediglich bestehende Technologien, Produkte oder Dienstleistungen verbessern, und solchen, die die Spielregeln in einer Branche neu definieren.
Disruption als Kampfbegriff
Aufgegriffen von der Start-up-Szene wurde der Begriff der Disruption schnell zum ökonomischen Kampfbegriff. Er steht für junge Unternehmen, zuvorderst aus dem Silicon Valley, die alte, etablierte Branchen mit neuen Technologien und neuen Geschäftsmodellen herausfordern. Die europäische Wirtschaft sehen Ökonomen dabei schlecht aufgestellt. Deren Stärke seien schrittweise Verbesserungen von Effizienz und Technologie, nicht aber bahnbrechende, sprunghafte Neuerungen. Das veranlasste die deutsche Bundesregierung, im Jahr 2018 die „Bundesagentur für Sprunginnovationen“, kurz „SPRIND“, zu gründen. Ziel: die Förderung disruptiver Technologien. Das ist der Hintergrund des Buches, das der Gründungsdirektor von SPRIND, Rafael Laguna de la Vera, zusammen mit dem Wirtschaftsjournalisten Thomas Ramge vorgelegt hat. Sein Titel, naheliegend: Sprunginnovation.
Der Begriff Sprunginnovation ist dabei mehr als eine bemühte Übertragung von Disruption ins Deutsche, sondern beinhaltet eine wichtige Bedeutungsverschiebung: „Eine Sprunginnovation verändert unser Leben grundlegend zum Besseren und macht es nicht nur ein wenig bequemer. Sprunginnovatoren finden mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik eine neue Lösung für ein relevantes Problem.“ (S. 6) Geläufige Beispiele sind Buchdruck, Dampfmaschine, Fließband und Internet, auch Penicillin, Wasserklosett, doppelte Buchführung und mRNA-Impfstoffe zählen dazu. Eine Sprunginnovation wirke wirtschaftlich disruptiv, sie „zerstört oft alte Märkte und schafft neue“, schreiben die Autoren, die sich zugleich aber vom kalifornischen Begriffsverständnis abgrenzen: „Die angeblich so disruptiven Plattformen aus dem Silicon Valley lösen Probleme, die wir eigentlich nie hatten“ (S. 9). Die Apps und digitalen Geschäftsmodelle seien Scheininnovationen, Innovationstheater. Dringend notwendig seien vielmehr „sprunghafte Innovationen, die das Leben einer größtmöglichen Anzahl von Menschen in größtmöglichem Umfang besser macht“ (S. 10). Kurz: „radikal bessere Technologie“ (S. 9).
Eine Fortschrittsdefinition
Es braucht also eine Fortschrittsdefinition, die sagt, was Innovation wirklich ausmacht. Die liefern die Autoren, und hierin liegt der entscheidende Wert ihres Buches. Ihre Definition wurzelt in den Werten der Aufklärung, bezieht das Prinzip der utilitaristischen Ethik – das größte Glück der größtmöglichen Zahl – mit ein und verbindet eine kollektive, globale mit einer individuellen Nutzenperspektive: konkret die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung mit den tief verankerten menschlichen Bedürfnissen, systematisiert in Abraham Maslows Bedürfnispyramide. Dies schaffe „ein deutlich besseres Verständnis, was technischer Fortschritt im 21. Jahrhundert heißen kann“ (S. 64). Nur Innovationssprünge könnten die Folgen der Industrialisierung bewältigen, lautet das bedenkenswerte Credo dieses Buches.
Ein empfehlenswertes Buch – mit Einschränkungen. Die Autoren fokussieren ausschließlich auf technischen Fortschritt. Soziale Innovation hingegen kommt nicht vor (abgesehen von der Nennung der doppelten Buchführung in der Beispielliste). Die Frage ist aber, ob es nicht gerade auch sozialer Innovationen bedarf, um aus der technologischen Sackgasse des Industriezeitalters herauszufinden. Das aber haben die Autoren nicht im Blick. Ihr ungebrochener Optimismus führt sie auch dazu, für eine Renaissance der Atomtechnik zu werben, ohne eingehende Begründung indes. Doch ihre Hoffnung auf „kleine, extrem sichere, besonders günstige Reaktoren“ (S. 206) ist nur eine weitere jener Verheißungen, die die Geschichte dieser Technologie von Anfang an begleitet haben. Vom technologischen Stand einer erneuerbaren Energieversorgung aus gesehen, ist Atomtechnik nichts weiter als ein Sprung zurück ins Dampfzeitalter.
Und, wie aktuell zu ergänzen ist, verlangt der Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Neubewertung der Atomtechnik im Hinblick auf Krisensituationen (genauer gesagt geht es um Erkenntnisse, die längst schon auf dem Tisch liegen). Dies in dreierlei Hinsicht: erstens die strategische Rolle von Atomanlagen als Angriffsziele in kriegerischen Auseinandersetzungen betreffend; zweitens im Hinblick auf die Resilienz der Technologie – denn paradoxerweise erfordert ein Atomkraftwerk, das ja zur Energieerzeugung dienen soll, im Fall einer Störung oder Abschaltung eine funktionierende Energieversorgung über das Stromnetz oder den sicheren Betrieb der Notstromaggregate zur Kühlung der Brennelemente; drittens im Hinblick auf die nukleare Nichtverbreitung (Proliferation). Auf diese Achillesferse jeglicher Nutzung spaltbaren Materials hatte Robert Jungk schon früh und mit Nachdruck hingewiesen. Für ihn war klar, dass es eine rein zivile Atomtechnik nicht geben kann.