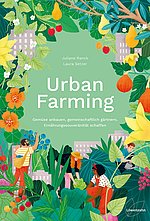Spätestens mit dem auf der UN Konferenz für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedeten „Agenda-21“-Prozess wurde Partizipation als ein Kernelement erfolgreicher Nachhaltigkeitsstrategien erkannt und eingefordert.
Die Mitwirkung von ExpertInnen aus Sozial-, Umwelt- und Politikwissenschaft, aus Architektur, Landschafts-, Stadtplanung und Erwachsenenbildung an der hier dokumentierten Tagung vom 23.9.2005 in Berlin belegt, dass der Zusammenhang von Partizipation und Nachhaltigkeit in vieler Hinsicht eine Querschnittematerie darstellt, die zunehmend in den Blick des wissenschaftlichen Interesses rückt. Wenngleich außer Streit steht, dass Nachhaltigkeit ohne Partizipation nicht zu haben ist, so überrascht doch der Befund, dass Partizipation selbst noch kein Garant für nachhaltige Entwicklung darstellt. Vielmehr liegt – in Anbetracht der Komplexität des Gegenstandes kaum anders zu erwarten – „der Teufel im Detail“.
Heike Walk bietet zunächst einen Überblick über Partizipation in der sozial-ökologischen Forschung und macht dabei unterschiedliche Traditionen und Intensitäten von Partizipation aus (als ‚top down’-Verfahren etwa in der kommunalen Planung und Verwaltung, im Kontext der Bewegungsforschung hingegen als ein Recht aus, das ‚von unten’ eingefordert und wahrgenommen wird). Im Folgenden werden Chancen und Risiken von Beteiligungsverfahren umfassend diskutiert (Wer initiiert Beteiligung? Wer darf oder soll sich beteiligen? Welche Methoden werden in Beteiligungsverfahren eingesetzt? Wie weit reicht Beteiligung?). Dabei stellt sich heraus, dass theoretische Begründungen für Partizipation oder im Prozess einer nachhaltigen Entwicklung weitgehend fehlen.
Dem Zusammenhang von Nachhaltigkeit, Partizipation und Macht geht in einem weiteren, einleitenden Beitrag Angela Oels nach, wobei sie aus Erfahrungen in der Begleitung von zwei Agenda-Prozessen zu dem überraschenden Befund gelangt, „dass für die Umwelt bei beiden rein gar nichts rausgekommen ist“ (S. 28). Nach der Diskussion der Machtkonzepte von Max Weber (repressiv) und Michel Foucault (konstitutiv), der Analyse von Diskursen in Zukunftskonferenzen „zwischen Ausbeutung und Einklang“ sowie dem Blick auf den Wandel des Verständnisses von „Nachhaltigkeit“ vor und nach 1998 in Deutschland, kommt Oels u. a. zu dem Ergebnis, „dass konsensorientierte Beteiligungsverfahren die Tendenz haben, den Status quo zu bestätigen und radikale Veränderungen abzuwenden. Für die Praxis lokaler Agenda-21-Prozesse heißt dies, dass neben einer Kooperationsstrategie am Runden Tisch immer auch konfliktorientierte Alternativen in Erwägung gezogen werden sollten…“ (S. 42).
Zu nachfolgenden drei Bereichen enthält der Band jeweils einen einleitenden Impulsbeitrag sowie eine Zusammenfassung der sich daran anschließenden Diskussion (auf die an dieser Stelle nur am Rande eingegangen werden kann). 1.) Machtstrukturen in partizipativen Nachhaltigkeitsprozessen: Wie erreichen wir nachhaltige Entwicklung? Wie können wir sie voranbringen? Woran liegt es, dass dabei Fortschritte nur sehr langsam vonstatten gehen? Edgar Göll, Mitarbeiter am IZT in Berlin, diskutiert diese Fragen vor dem Hintergrund der „Asymmetrie der Macht“, die er mit K. W. Deutsch „als die Fähigkeit, nicht lernen zu müssen“ definiert. Macht resultiere demnach aus der Positionierung innerhalb eines Systems, der Handlungsfähigkeit, der Verfügbarkeit von diversen Ressourcen sowie von Diskursfähigkeit. Dass nach einer Erhebung in Deutschland aus dem Jahr 2004 zwar 33% der Befragten sich vorstellen können, sich im Umweltschutz zu engagieren, dies aber tatsächlich nur 4% tun, verweise auf Chancen sowie das Manko einer stärkeren Verbindung von Partizipation und Nachhaltigkeit, so Göll. Um hier gegenzusteuern, votiert der LA-21-Experte u. a. für ein „matching“ zwischen den Interessen der ehrenamtlich Tätigen und den einschlägig wirkenden Organisationen, für die Thematisierung von Machtasymmetrien, und die „Ermöglichung und Präsentation von Erfolgen und Effekten“.
2.) Partizipationsverfahren für eine nachhaltige Entwicklung: Partizipationsprozesse gestalten: Worauf kommt es (nicht) an? Unter diesem Titel stellt Britta Rösener zunächst dar, dass Partizipation nicht an einem Mangel an Methoden, sondern vielmehr oft daran scheitert, „dass den Prozessen wesentliche Voraussetzungen wie Kompetenz, Interesse oder politischer Wille fehlen und dass - bevor die Frage nach den Methoden gestellt wird - Aufgaben, Ziele, Zielgruppen, Rahmenbedingungen Ressourcen nicht miteinander in Einklang gebracht sind.“ (S. 76) Beteiligungsprozesse bräuchten vor allem Fürsprecher und Kommunikationskonzepte, die folgende Punkte zu klären hätten:
1. Was ist Gegenstand der Beteiligung, was sind Ziele und Leidfragen?
2. Wer sind die Zielgruppen?
3. Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
4. Welche Rahmenbedingungen gibt es?
5. Und dann erst: Wie ist die Kommunikation zu gestalten?
6. Welche Methoden setzen wir ein?
Auch gelte es, so ein zentraler Befund der Diskussion, die Zielgruppe „dort abzuholen, wo sie steht“; Beteiligung sei zudem nur dort sinnvoll, wo sie dem Projekt zuträglich und wo für die TeilnehmerInnen Entscheidungsbefugnisse geschaffen werden, die ihnen auch nachvollziehbar sind.
3.) Gesellschaftliches Lernen in partizipativen Nachhaltigkeitsprozessen: Ute Stoltenberg, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Lüneburg, geht in ihrem Statement davon aus, dass ein Lernen für Nachhaltigkeit von zwei Prinzipien ausgehen sollte: Nachhaltige Entwicklung sei „gesellschaftlicher Lern- und Suchprozess“, Partizipation ein Ort dafür (S. 96). Nachhaltigkeit sei zudem „kein diffuse Begriff, sondern ein ethisches Prinzip, dessen Beachtung einen komplexen Prozess gesellschaftlichen Handelns erfordert“. Um Nachhaltige Entwicklung als „Lern und Suchprozess unter einem normativen Leitbild zu verstehen“ (S. 97), lohne ein Perspektivenwechsel: erforderlich sei die integrative Betrachtung der sozialen, ökonomischen, kulturellen und ökologischen Dimension; die Beachtung nachhaltigkeitsrelevanten Wissens und Nichtwissens und die Berücksichtigung der Strategien für nachhaltige Entwicklung. Für die Wissenschaft gehe es dabei v. a. auch um die Produktion von „ sozial robustem Wissen“ sowie die Bereitstellung von Räumen für Partizipation. Einerseits im wörtlichen Sinn durch die Zugänglichkeit zu von Begegnungs-, Kommunikations- und Gestaltungsräumen, andererseits durch die Schaffung sozialräumlicher Strukturen in Bildungseinrichtungen, Betrieben oder Stadtteilen. Partizipationsprozesse, so die Expertin weiter, sollten „zielgerichtet auf spezifische Fälle und Aufgaben hin orientiert sein. Das erhöht die Chance der Beteiligung - im Gegensatz zu Prozessen, die von einer allgemeinen auf „die Kommune“, „die Stadtentwicklung“ oder „Wie wollen wir leben?“ ausgerichteten Frage ausgehen (S. 101). Um sich an der Produktion gesellschaftlich robusten Wissens zu beteiligen, bedürfe Wissenschaft demnach selbst der Partizipation; daher sollten WissenschaftlerInnen selbst vermehrt die Rolle von Katalysatoren, Moderatorinnen und Partizipationsprozessen übernehmen, so Stoltenberg.
Insgesamt ein spannender, facettenreicher Einblick in den aktuellen Stand sozial-ökologischer Forschung, der zugleich darauf verweist, dass es in diesem Kontext noch jede Menge zu tun gibt.
Partizipation und Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung. Hrsg. v. Helga Jonuschat … München: oekom-Verl., 2007. 135 S. € 24,90 [D], 25,70 [A], sFr 43,60 ISBN 978-3-86581-025-0