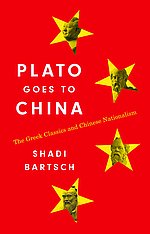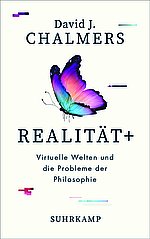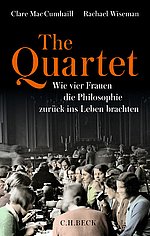Der Essay „Die Freiheit, frei zu sein“ wurde erst jetzt erstmals veröffentlich, obwohl die Autorin Hannah Arendt bereits 1975 verstorben ist. Sie hatte ihn in Zusammenhang mit ihrem 1963 erschienenen Buch „On Revolution“ verfasst. Er widmet sich der historischen Entwicklung des Freiheitsbegriffes, vor allem in seiner Verbindung mit den Revolutionen in der Menschheitsgeschichte. Neben der Freiheit von Zwang, der negativen Freiheit, skizziert Arendt mit Hilfe des Philosophen John Adams einen weiteren Begriff der Freiheit. Menschen seien von dem Wunsch bestimmt, von anderen Menschen gehört, angesprochen, anerkannt und respektiert zu werden. Dahinter stehe die Leidenschaft der Profilierung. Das sei abzugrenzen vom Wunsch, Macht zu haben. In einem Wettbewerb der oder die Beste zu sein, setze Gleichheit unter den Beteiligten voraus. Institutionell ist diese Art von Freiheit „allein in der Republik möglich, die keine Untertanen und, streng genommen, auch keine Herrscher kennt.“ (S. 22) Für diesen zweiten Schritt der Freiheit gab es historisches Bewusstsein, schreibt Arendt: „Die Männer der ersten Revolutionen wussten zwar sehr wohl, dass Befreiung mehr bedeutet als politische Befreiung von absoluter und despotischer Macht; dass die Freiheit, frei zu sein, zuallererst bedeutete, nicht nur von Furcht, sondern auch von Not frei zu sein.“ (S. 24) Die Radikalität ihres Freiheitsbegriffes ist Arendt klar. Freiheit war für die VorkämpferInnen das Schaffen von etwas Neuem. Die Erfahrung frei zu sein, fiel mit dem Beginn von etwas Neuem zusammen. „Man hatte das Gefühl: Frei zu sein und etwas Neues zu beginnen, war das Gleiche.“ Etwas spekulativ schreibt sie nachfolgend: „Und diese geheimnisvolle menschliche Gabe, die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu tun, das jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. Mit anderen Worten: Wir können etwas beginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind.“ (S. 37)