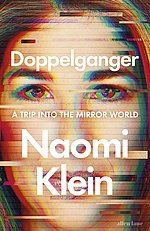Eine Pandemie ist nicht nur ein medizinisches Problem sowie eines von Public Health, sondern hat auch weitreichende gesellschaftliche Implikationen. Es ist der Verdienst des transcript-Verlags, dass er bereits kurz nach Ausbruch der Pandemie „seine“ Autorinnen und Autoren aufgerufen hat, Analysen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu geben. Herausgekommen ist mit Die Corona-Gesellschaft ein umfangreicher Band mit insgesamt 40 Beiträgen von weitgehend hoher Qualität und Aktualität, die ganz unterschiedliche Aspekte des Themas aufgreifen. Beispielhaft seien nachfolgend einige davon kurz besprochen.
Franz Mauelshagen gibt Einblicke, wie Gesellschaften in der Geschichte mit Pandemien umgegangen sind. Quarantäne war, solange es keine Impfstoffe gab, demnach die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung von Viren zu begrenzen. Und Pandemien seien immer die Sternstunde für einen starken Staat, der jedoch nur seine Wirkung entfalten könne, wenn er das Vertrauen seiner Bürgerinnen und Bürger genieße. Herfried Münkler verweist darauf, dass nicht die Pandemie selbst, jedoch die Strate-gien zu ihrer Bewältigung geopolitische Auswirkungen haben werden.
Der Virus betrifft nicht alle gleich
Viele Beiträge verweisen darauf, dass Corona keineswegs alle Menschen in gleicher Weise betrifft. Der „infizierte Körper“ sei durchaus sozial determiniert, so die Soziologinnen Gabriele Klein und Katharina Liebisch: „Wie er durchkommt, darüber entscheiden im Wesentlichen kulturelle, ökonomische und soziale Ressourcen und die Zugänge zu ihnen.“ (S. 60) Die beiden führen die Metapher vom „individuellen“ und „kollektiven“ Körper ein. Einander nicht zu gefährden bedeute, Abstand zu halten. Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder Demonstrationen könnten bald der Vergangenheit angehören, dagegen trete der „imaginäre Kollektivkörper einer Weltgefahrensgemeinschaft“ (S. 62) in den Mittelpunkt. Gut möglich, dass die Politik im 21. Jahrhundert diesem Szenario folge.
Die Pandemie verändert unseren Lebensalltag und unsere Routinen, wie einige weitere Texte ausführen. So hat der Lockdown zu einem „empfindlichen Geselligkeitsverlust“ (Stefan Hirschauer, S. 218) und zur Aufwertung der Wohnung sowie der Familie geführt, er zeige uns aber auch, so Sascha Dickel, wie stark die „Mediatisierung“ (S. 83) unserer Gesellschaft bereits vor Corona gediehen gewesen sei.
Verhältnis von Corona- und Klimakrise
Mehrere Beiträge fokussieren auf das Verhältnis von Corona- und Klimakrise. Eleonora Rohland verweist auf den Zeitfaktor in der Risiko- und Gefahrenwahrnehmung. Anders als bei der Klimakrise werde bei der Pandemie auf eine unmittelbare Bedrohung reagiert, auch wenn die Erderwärmung die Ausbreitung tropischer Krankheiten verstärken werde. Die Ansicht, dass die aktuelle Pandemie nicht die letzte gewesen sein wird, taucht ebenfalls in mehreren Beiträgen auf. Unsere gesellschaftliche Krise sei nur ökologisch zu beschreiben, so Frank Adloff: „Verschiedene Spezies sind voneinander abhängig, werden angeeignet, bedrohen einander, unterstützen uns, verändern einander.“ (S. 149) Die Soziologie sei bisher meist von der Prämisse „relativ stetigen sozialen Wandels“ (S. 151) ausgegangen, müsse sich aber viel stärker auch der Gefahr von Kipppunkten und Disruptionen zuwenden. Eine wichtige Frage der Zukunft lautet für den Politikwissenschaftler, ob es gelingen könne, die Angst in eine Wahrnehmung unserer gemeinsamen Verletzbarkeit und Abhängigkeit umzuleiten. Wenig Hoffnung darauf hat Ingolfur Blühdorn, der eine Befestigung der „Gesellschaft der Nicht-Nachhaltigkeit“ (S. 240) durch die Krise befürchtet; sowie laut Ulrike Guérot „das rechtspopulistische und nationalistische Aufbegehren gegen die EU über die Zeit der eigentliche Gewinner der Corona-Krise“ (S. 297) sein könnte. Stephan Lessenich wiederum befürchtet die Verschärfung des Leistungsdrucks und einen weiteren Abbau von Sozialleistungen unter dem Deckmantel des Ausnahmezustands.
Ökonomische Fragen werden nur am Rande angesprochen. Die Nachhaltigkeitsforscherin Katharina Manderscheid hält eine „stärkere Regionalisierung von Produktions- und Verwertungszusammenhängen“ (S. 103) für durchaus möglich, zugleich könnte die globale Zusammenarbeit in der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen steigen. Da setzt auch Silke Helfrich an, wenn sie eine Vergemeinschaftung der medizinischen Forschung fordert, außerdem für die Stärkung des zivilen Sektors als Krisenvorsorge plädiert. Als Beispiel nennt sie eine digitale Plattform der Stadtverwaltung von Istanbul, über die Einkommensstärkere in der Krise die Mietkosten von sozial Schwächeren getragen haben. Helfrich verweist auf die Wachstumsabhängigkeit unseres Wohlfahrtssystems sowie das Dilemma der Abhängigkeit von Staat und Markt. Das Herunterfahren der Wirtschaft, des Konsums und der Mobilität sei aus ökologischen Gründen auch ohne Corona notwendig. Doch „eben dieses Kein-Geld-Brauchen, nicht mehr fliegen und weniger einkaufen, tritt uns umgehend als Katastrophe gegenüber, die es zu bekämpfen, zu überbrücken, zu vermeiden gilt.“ (S. 373) Klaus Dörre möchte diesem Dilemma mit „Transformationsräten“ und „kollektiven Eigentumsformen“ (S. 319) abhelfen, denn der Übergang zu einer dekarbonisierten, ressourcenschonenden Wirtschaft sei „ohne langfristige gesellschaftliche Planung kaum zu bewerkstelligen“ (ebd.).
Pandemien werden uns weiter begleiten
Es wird sich zeigen, ob und auf welche Weise die Corona-Krise das Verhältnis von Markt, Zivilgesellschaft und Staat verändert. Prognostiziert wird ein stärkerer „Staatsinterventionismus“ (Dörre, S. 320), der Übergang vom neoliberalen zu einem „resilienten Staat“ (Andreas Reckwitz, S. 247) sowie die dauerhafte Etablierung „sozialer Immunsysteme“ (Rudolf Stichweh, S. 204), denn Pandemien würden – so ein Tenor des Bandes – uns im 21. Jahrhundert weiter begleiten. Das Sicherheitsversprechen der Moderne sei erschüttert und „das Einschlagen neuer Wege (…) daher unabdingbar“, bringt dies Katharina Block auf den Punkt (S. 156).