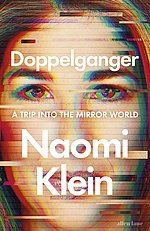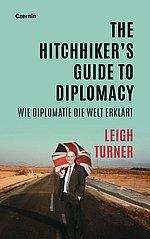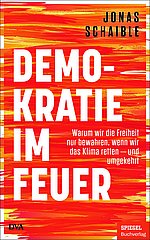Galten Unternehmensführer 2001 noch für 60 Prozent der Befragten als Hoffnungsträger, so sahen dies zehn Jahre später nur mehr 20 Prozent so. Banker rangieren mittlerweile laut Allenspacher Berufsprestigeskala an letzter Stelle, nur mehr 3 Prozent schreiben ihnen die Qualität von Zukunftsgestaltern zu. Grund genug für das Göttinger Institut für Demokratieforschung, dem Selbstbild der Wirtschaftseliten auf den Zahn zu fühlen. In rund 160 Einzelinterviews wurden die Einstellungen deutscher Führungskräfte zu Gesellschaft, Politik, Leistung, Gerechtigkeit oder Geschlechterrollen erhoben. Selbst- verständlich handelt es sich bei den Ergebnissen um subjektive Einschätzungen, um Selbstauskünfte oder teilweise gar – wie Matthias Micus als einer der Studienautoren einmal meint – mitunter gar um „phantastische Selbstsuggestionen” (S. 264).
Galten Unternehmensführer 2001 noch für 60 Prozent der Befragten als Hoffnungsträger, so sahen dies zehn Jahre später nur mehr 20 Prozent so. Banker rangieren mittlerweile laut Allenspacher Berufsprestigeskala an letzter Stelle, nur mehr 3 Prozent schreiben ihnen die Qualität von Zukunftsgestaltern zu. Grund genug für das Göttinger Institut für Demokratieforschung, dem Selbstbild der Wirtschaftseliten auf den Zahn zu fühlen. In rund 160 Einzelinterviews wurden die Einstellungen deutscher Führungskräfte zu Gesellschaft, Politik, Leistung, Gerechtigkeit oder Geschlechterrollen erhoben. Selbst- verständlich handelt es sich bei den Ergebnissen um subjektive Einschätzungen, um Selbstauskünfte oder teilweise gar – wie Matthias Micus als einer der Studienautoren einmal meint – mitunter gar um „phantastische Selbstsuggestionen” (S. 264).
Insbesondere sehen sich die Befragten als zentrale Leistungsträger der Gesellschaft mit hoher Verantwortung vor allem gegenüber ihren Belegschaften. Einkommen für die MitarbeiterInnen und deren Familien zu sichern, wird als hoher Wert herausgestellt. Davon abgeleitet wird ein Gerechtigkeitsverständnis, welches eben auf Leistung basiert. Pflicht und Verantwortung aller wird eingefordert, der Begriff der Solidarität jedoch skeptisch beurteilt, ebenso eine zu starke Einmischung des Staates. Während Unternehmer permanent Verantwortung tragen, könnten PolitikerInnen diese auf die nach ihnen Kommenden oder gar auf nächste Generationen abschieben, so ein weiteres Indiz der positiven Selbsteinschätzung der Wirtschaftseliten.
Neben Pauschalurteilen wie der „Umverteilungssucht der Politiker” (S. 311) oder der Affinität zum Neiddiskurs werden aber auch differenzierende Befunde sichtbar: zentral erscheint die Garantie von Rechtsstaatlichkeit, Gewerkschaften und Tarifpolitik werden von Industrieführern als Bestandteil eines kooperativen Systems akzeptiert und eher von Familienbetrieben abgelehnt. Das politische Engagement der Wirtschafseliten nehme ab und die politische Zugehörigkeit verliere an Eindeutigkeit, so ein weiterer Befund. Gesprochen wird eher von „politischer Heimatlosigkeit” (S. 333). Der Sozialdemokrat Gerhard Schröder wird von vielen als Politiker mit Wirtschaftsverstand gelobt, Angela Merkel auch kritisiert. Bemerkbar sei ein Faible für das „chinesische Modell”, welches dem Tempo des globalen Wettbewerbs möglicherweise besser entspreche als langwierige demokratische Aushandlungsprozesse. Keine Sympathien erfahren direktdemokratische Ansätze; und als größter Feind werden – das mag überraschen – mittlerweile die Medien ausgemacht, die „skandalisieren”, „Lawinen lostreten”, “Hetzjagenden” betreiben. Dahinter stehe freilich, so die Autoren, auch der Verlust an Macht durch mehr Öffentlichkeit und Transparenz.
Bei aller verbalen Betonung ethischer Handlungsgrundlagen zeige sich, so eine Interpretation der Studienautoren, eine Tendenz zur wirtschaftlichen Engführung von sozialen Werten: „Im Gerechtigkeitsbild deutscher Unternehmer sind ihre Mitarbeiter – ebenso wie sie selbst – Humankapitalisten. Jeder ist sein eigener Unternehmer. Wissen, Leistungsfähigkeit, Arbeitskraft und Gesundheit sind Ressourcen, die individuell aufgebaut, gemehrt, erhalten werden müssen.” (S. 271) Dass wirtschaftliche Chancen und Möglichkeiten (noch immer) häufig vererbt werden, bleibe dabei ebenso außen vor, wie die mittlerweile ja bekannten eklatanten Einkommens- und Vermögensunterschiede. Womöglich insistieren die Firmenlenker auch deswegen so stark auf soziale Werte, so eine Interpretation der AutorInnen, weil ihnen die neoliberale Schlagseite ihres Freiheitsverständnisses durchaus bewusst sei und sie “ihre Entbürokratisierungsforderungen und Steuersenkungsbegehren durch den Verweis auf das Gemeinwohl zu legitimieren suchen” (S. 273). Auch die vorgegebene “rastlose Betriebsamkeit” und das Balancieren zwischen “Flow und Erschöpfung” (S. 321) entspricht dem Selbstbild des Leistungsträgers. Über Überforderung oder gar Burnout werde aber ungern gesprochen, was der Selbstzuschreibung vom erfolg-reichen Gestalter widerspreche. “Leistung” habe andere soziale Motivationen, etwa religiöse Überzeugungen, abgelöst. Bereits 40 Prozent der Befragten bezeichneten sich als konfessionslos. Das Unternehmen gut zu führen, nach Möglichkeit Umsätze und Gewinne zu vergrößern und damit zum „Gemeinwohl“ beizutragen, wird als eine Art „säkularisierte Mission“ (S. 329) bezeichnet.
Aufschlussreich erscheint auch die Differenzierung innerhalb der Unternehmerschaft sowie die Abgrenzung gegenüber Imageschädigern: “Die Familienunternehmer grenzen sich gegenüber Großunternehmern und Managern, also im Prinzip gegenüber allen anderen ab, die Großunternehmer gegenüber den Managern und die Manager gegenüber den schwarzen Schafen aus der eigenen Gruppe.” (S. 262)
Resümee: Eine Untersuchung, die Aufschluss gibt über das Selbstbild deutscher Wirtschaftseliten und die ihren Wert aus den sozialwissenschaftlichen Interpretationen der Befunde sowie dem Vergleich der Ergebnisse mit anderen soziologischen Befunden bezieht. Aufgeräumt wird dabei auch mit Klischees etwa der notwendigen Internationalität von Wirtschaftseliten – zwei Drittel der Befragten verfügten über keinerlei Auslandserfahrungen – oder dem Unternehmenspatriarchen, der einsam seine Entscheidungen treffe. Unternehmen bräuchten heute eine kooperative Führung, um der Komplexität der Anforderungen gerecht zu werden. Die Autoren nennen das „postheroisches Verhalten“. Hans Holzinger
![]() Sprachlose Elite? Wie Unternehmer Politik und Gesellschaft sehen. Hrsg. v. Fritz Walter u. Stine Marg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2015. 350 S., € 16,95 [D], 17,50 [A] ; ISBN978-3-498-04213-4
Sprachlose Elite? Wie Unternehmer Politik und Gesellschaft sehen. Hrsg. v. Fritz Walter u. Stine Marg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2015. 350 S., € 16,95 [D], 17,50 [A] ; ISBN978-3-498-04213-4