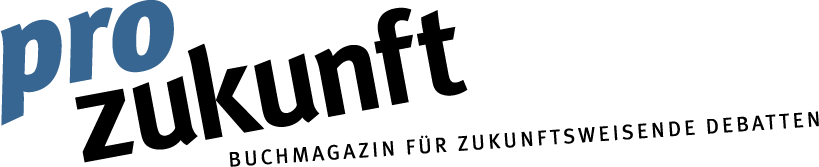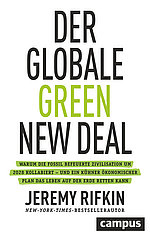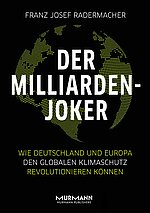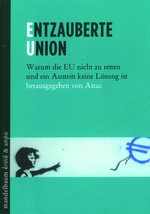Eine im Juni 1994 vorgelegte, vom renommierten Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag von Greenpeace durchgeführte Studie über die umwelt- und beschäftigungspolitischen Auswirkungen einer Ökosteuer hat viel Staub in Politik und Wirtschaft aufgewirbelt und der angesichts von Wirtschaftsrezession, Wiedervereinigungskosten und Standortdebatten zu erschlaffen drohenden ökologischen Diskussion zu neuem Leben verholfen. Die Ergebnisse der Studie machen den Kern dieses neuen Greenpeace-Buches aus, das um weitere wertvolle Beiträge zur politischen Brisanz des Themas ergänzt wurde. Zur Erinnerung: Das DIW-Modell sieht eine Besteuerung des Energiegehalts von Strom, Benzin, Heizöl, Diesel sowie Erdgas - und zwar mit 63 Pfennig je Gigajoule - vor. Die Steuerlast soll jährlich um 7 % wachsen, was die Staatseinnahmen innerhalb von 10 Jahren von 8,6 auf 121 Milliarden DM wachsen ließe. Diese Mehreinnahmen sollen - laut DIW-aufkommensneutral an die Unternehmen (Lohnkostensenkung) und Haushalte (Ökobonus) rückerstattet werden. Die C02-Emmissionen könnten durch diese Umgestaltung des Steuersystems bis zum Jahr 2005 um gut 21 % gesenkt werden, zugleich würden aber - und das macht das Konzept so interessant - über 600 000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Auch wenn Szenarios immer nur Annäherungswerte vermitteln können, so sind sie doch - dies beweist ein einführender Beitrag des ZEIT-Redakteurs Fritz Vorholz über die Ökosteuerdebatte in der BRD und weitere Konzepte, etwa jenes von Ernst U. v. Weizsäcker - das Ferment öffentlicher Auseinandersetzung. So fällt es auch der Industrie immer schwerer, ihr striktes Nein gegen Energiesteuern aufrechtzuerhalten, wie ein ebenfalls wiedergegebenes ZEIT-Gespräch zwischen dem Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie HansOlaf Henkel und DIW-Präsidenten Lutz Hoffmann demonstriert. Der Band wird weiter bereichert durch Beiträge von Hans-Peter Dürr, der unser gegenwärtiges Wirtschaften in den Kontext der Evolutionsgeschichte der Natur stellt, sowie der" Wuppertaler" Manfred Fischedick und Peter Hennicke, die eine Ökosteuerreform ergänzende Maßnahmen wie den Aufbau einer Energiesparinfrastruktur darlegen. Die DIW-Mitarbeiterin Barbara Praetorius und der Journalist Thomas Worm geben schließlich einen interessanten Überblick über den Stand von Ökosteuerreformen in ausgewählten europäischen Staaten sowie den "Rückzieher" auf EU-Ebene.
Die ökologische Steuerreform ist ein "Politikum ", meint Ernst U. v. Weizsäcker im Geleitwort des Bandes zu Recht. Um jene "kritische Masse" (Dürr) zu erreichen, die sie mehrheitsfähig macht, bedarf es noch einiger Bewußtseinsbildung. Das vorliegende Buch ist ein wertvoller Impuls hierzu. H. H. Zu ebenfalls positiven Schlüssen kommt eine, da mit zahlreichen Formeln bespickt, eher Fachleuten vorbehalten bleibende Abhandlung von Ronnie Schöb, der eine Einbettung von Energiesteuern in das Gesamtsteuersystem sowie dadurch zu erwartende Veränderungen der Konsumstrukturen vornimmt: Schob, Ronnie: Ökologische Steuersysteme. Umweltökonomie und optimale Besteuerung. Frankfurt/M. (u. a.): Campus, 1995. 266 S.
Der Preis der Energie. Plädoyer für eine ökologische Steuerreform. Hrsg. v. Greenpeace e. V Bach, Stefan ... (Mitarb) München: Beck, 1995. 231 S. (BsR; 7122)