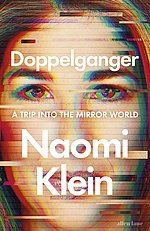„Es beginnt bei mir und endet in uns allen.“ Keine der mir bekannten Publikationen zu Körper- und Schönheitspolitiken der letzten Jahre konnte den Brückenschlag zwischen individueller Erfahrung von Schönheitsdruck und seiner strukturellen, historisch-politischen Bedingtheit so überzeugend und auf so vielfältige Art und Weise herstellen wie Moshtari Hilals „Hässlichkeit“. Neben kulturtheoretischen Analysen ergänzen tief berührende, lyrische Passagen und visuelle Kunst Hilals Rundumschlag gegen Körperscham und Ekel.
In fünf Kapiteln erzählt Hilal – visuelle Künstlerin, Autorin und Kuratorin – die Geschichte ihres Körpers. Sie ergründet den gesellschaftlichen Hass hinter unseren Vorstellungen von Hässlichkeit und weist basierend auf tiefgehender Recherche den Weg zu einer mit ihren Körpern versöhnten Gesellschaft. Sie zeigt auf, was (ihren) Körper zu(m) anderen macht und zerlegt präzise die strukturellen Bedingungen für Ausgrenzung. Erst vor dem Hintergrund eines kolonialen, weißen Schönheitsideals erscheinen dunkle Haare am Körper als Fehler, erst durch Antisemitismus und rassistische Physiognomie werden große Nasen zum individuellen, von ihren Träger*innen zu berichtigenden Problem. Erst gesellschaftliche Zwänge machen Schönheit zur Pflicht und Hässlichkeit zu „persönlichem Versagen“ (S. 103). Dabei streben Marginalisierte oft nicht nach Idealen, sondern danach, „in der Masse unterzugehen“ (S. 22). Ihre Versuche der Imitation sind nicht oberflächlich, sondern existenzielle „Überlebensstrategie“ (ebd.).
„Hässlichkeit“ ist durchzogen von lyrischen Passagen, deren affektive Schlagkraft einem beim Lesen oft den Atem raubt: „Nichts ist hässlich an dem Anblick eines geliebten Menschen, der in Krankheit seinen Körper verliert, am Anblick einer Ruine, von der wir wissen, was sich in ihr verbirgt, hinter, unter, vor ihren Trümmern. […] Das Sterben des geliebten Menschen bleibt das Hässlichste“ (S. 176f.). Hilal reklamiert für sich schlussendlich im Kapitel „negierte Schönheit“ nicht einen Platz innerhalb der Schönen, sondern plädiert dafür, „uns an die Seite der Hässlichen [zu] stellen“ (S. 209), denn erst das Zulassen von Hässlichkeit lehrt uns Verletzlichkeit, Intimität und Vertrauen. Erst durch die Versöhnung mit Hässlichkeit können wir unsere Menschlichkeit und damit auch Sterblichkeit anerkennen.