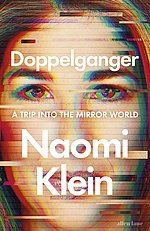Anna Mayr hadert mit ihrer eigenen Bürgerlichwerdung, erklärt ihre Zerrissenheit in einem kapitalistischen System, das nicht gerecht, aber durchaus angenehm ist, je nachdem, wo man sich eben in ihm befindet. Sprach sie in ihrem ersten Buch „Die Elenden“ (2020) von persönlichen, finanziell prekären Erfahrungen, zeigte dabei, wie notwendig perfider Weise Armut und Arbeitslosigkeit sind, um das soziopolitische Gesellschaftssystem, wie es gerade funktioniert, weiter funktionieren zu lassen, so beschreibt sie nun eine Lebenswirklichkeit, die sich in Bezug auf Geld nicht mehr durch Sorgen oder Nöte definiert. Sie gewährt dem folgend Einblick in einen Alltag voller veränderter Bewertungs- und Handlungsmuster, durch welche sich die Autorin ob ihrer eigenen Verhaltensweisen, in selbstkritischer Wahrnehmung und Reflexion, zeitweise beschämt, vor allem irritiert sieht: „Ich will dieses Leben nicht anders, ich habe lieber Geld als kein Geld. Aber ich mag den Menschen, zu dem ich mit Geld geworden bin, nicht besonders“
(S. 9). Und: „Ich bin wie all diejenigen, die ich einst wachrütteln wollte. Eat the rich, darf man das noch rufen, wenn man sich damit selbst den Fuß abbeißen würde?“ (S. 11).
Zu 16 Kaufentscheidungen, von ihr selbst oder von Bekannten getroffen, nimmt uns Mayr mit, um am konkreten Beispiel über Gerechtigkeit sowie Sinn und Unsinn von Konsum zu schreiben. In jedem dieser Kapitel werden sozialpolitische Strukturen und Annahmen in Frage gestellt. In „600 Euro für einen Umzug“ etwa wird der Wert einer Arbeitsleistung hinterfragt: die tradierte Idee, dass bestimmte Arbeit weniger wert sei als andere, sowie der Glaube an diese Hierarchie, garantieren scheinbar die Sicherheit der Marktwirtschaft. Eigentlich aber, so Mayr, würde das Prinzip der Arbeitsteilung, wenn man ernsthaft darüber nachdenken würde, Lohngleichheit voraussetzen. Nicht nur in „149 Euro für einen Elektrogrill“ fokussiert die Autorin im Weiteren beispielsweise auf den Zusammenhang von Leistung und Erfolg, wenn sie das Gerede von einem Leistungsprinzip, von einer Leistungsgesellschaft an sich, als große Lüge analysiert (vgl. S. 99). All diese Beobachtungen, mit die Gesamtgesellschaft widerspiegelnden Statistiken und Rechercheergebnissen unterfüttert, bleiben
narrativ isoliert als solche stehen, ohne dass Antworten oder Handlungsanweisungen folgen, ohne dass die benannte Irritation der Autorin selbst eine Auflösung findet. Für eine sinnvolle und diskurseröffnende Auseinandersetzung ist das ja aber auch gar nicht nötig.