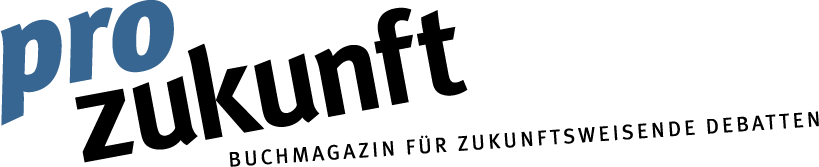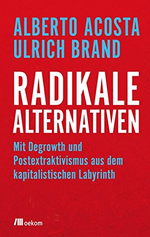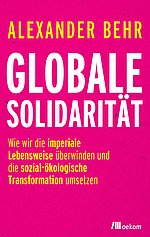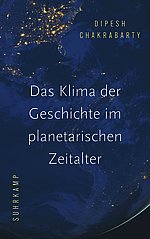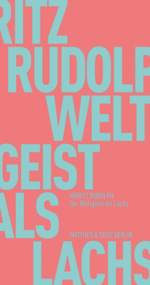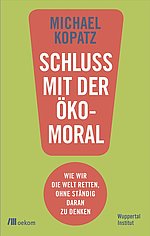Die begründete Sorge um die Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherung hat der Aufmerksamkeit gegenüber ökologischen Fragestellungen in jüngster Zeit erheblich zugesetzt. Umso wichtiger ist es, daß das "Jahrbuch Ökologie" den seit Jahren erfolgreichen Kurs konsequent beibehält: Auch die jüngste Ausgabe, die in bewährter Struktur 30 (von insgesamt 45 Autorinnen gestaltete) Beiträge umfaßt; zeichnet sich durch Aktualität, Vielfalt und kritische Reflexion ebenso aus wie durch (trotz allem) immer wieder auch konkrete Projekte, die signalisieren, daß es lohnt, das Thema Ökologie auch in einer Phase konjunktureller Flaute beharrlich zu verfolgen. In einem streitbaren, Carl Amery zum 7S. Geburtstag gewidmeten Beitrag stellt Günther Schiwy eingangs die Frage, ob denn "Christen deshalb so lustlose und wenig engagierte Erdenbürger (seien), weil sie auf die ,Neue Erde' warten und das Ende der ,ersten Erde' umso mehr herbeiwünschen, als diese nicht mehr lebenswert, geschweige denn liebenswert erscheint?" (S. 13) - und fordert "den Abschied vom allmächtigen Gott". "Warum Menschen ihr Verhalten nicht ändern", diskutieren im folgenden S. Leuning und J. Haider (in einer Entgegnung auf Thea Bauriedl). Trotz der evolutionär bedingten "Kurzsichtigkeit" des Menschen, so ihr Resümee, sei ein "Dualismus von objektiver Erkenntnis, daß es für die Welt voraussichtlich keine Rettung mehr geben kann, und subjektiv-pragmatisches Engagement für eben diese Rettung" (S. 29) angebracht, daß dazu u.a. auch "neue Märchen" beitragen könnten - vgl. auch die "Leseprobe" dieser Ausgabe - ist Thema von W. Schenkel und Chr. Axt. Die "Schwerpunkte" diskutieren (1.) Möglichkeiten einer "ökologischen Globalisierung" (wobei es- im Einzelnen um die Bereiche Klima, Handel als Umweltschutzfaktor, „lnstitutionenlernen" (exemplarisch erläutert anhand des "Ozon-Fonds") und ein weltweit verbindliches Waldschutzabkommen geht), erörtern (2.)das Erfordernis biologischer Vielfalt (hier besonders hervorgehoben sei P. Hasenkamps Votum für sein Wiederaufforstungsprojekt "Prima Klima" mit dem Ziel, durch das Pflanzen von 10 Mio. km2 Waldes (- 7 % der Landmasse weltweit) dem Ziel der CO2-Neutralität nahezu kommen, und stellen (3.) umweltmedizinische Aspekte zur Diskussion (u.a.). Reichert über "Hormonelle Sabotage der Fortpflanzung"). Im "Disput" sind diesmal A Merkel, J. Flasbarth und G. Altner über den Weg (der BRD)zur Nachhaltigkeit, von M. Heymann findet sich ein Beitrag zur Geschichte der Windenergienutzung, und neun Mal wird Ermutigendes aus der Praxis ökologischen Engagements vorgestellt, wobei das Spektrum von der Hilfe für Kinder aus Tschernobyl über die Freude naturnahen Gärtnerns und sanften Tourismus (mit den "Naturfreunden") bis hin zu Erfahrungen mit Umweltfonds und Fortschritten bei der Umsetzung von "Faktor 4" reicht. In der abschließenden "Spurensicherung" geht es um Begriffliches ("Natur" versus "Umwelt"), Juristisches (die Resolution der WHO über Klonen und menschliche Reproduktion im Wortlaut) und allzu Bürokratisches (bundesdeutsche? Behördenwillkür im Umgang mit BSE). - Nicht nur da geht einem ein Licht auf. W Sp.
Jahrbuch Ökologie 1998. Hrsg. v. Günter Altner ...München: eec« 1997. 288 S. (Beck'sche Reihe; 7228)