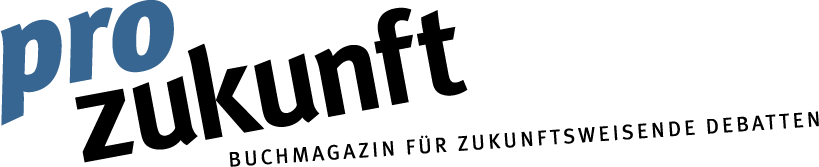Editorial 1993/4:
Die Umweltzerstörung, so hört man derzeit häufig, sei wesentlich eine Folge der rasant zunehmenden Weltbevölkerung. Dieses Argument ist nicht ganz falsch, gleicht jedoch dem Versuch der Täter, die Hauptschuld auf die Opfer abzulenken. Denn wer von Bevölkerungsexplosion spricht, meint doch damit zunächst und vor allem das enorme Bevölkerungswachstum in der sogenannten Dritten Welt. Aber was sagt dies über die Umweltzerstörung auf der Erde aus? Mitte 1990 lag die Gesamtbevölkerung der Erde bei etwa 5,3 Milliarden, von denen etwa 80% (etwa 4,1 Milliarden) in den ärmeren Ländern (mittleres Jahreseinkommen unterhalb $ 8000) und die übrigen 20% (etwa 1,2 Milliarden) in den reichen Ländern leben. Nach heutigen Schätzungen ist das mittlere Bevölkerungswachstum der "Armen" etwa 1,6%, was einer Verdopplungszeit von 43 Jahren entspricht, während die "Reichen" mit nur etwa 0,3% zunehmen. Vom Standpunkt des „Umweltverbrauchs" sieht dieser Vergleich jedoch ganz anders aus, wenn wir berücksichtigen, dass das reichere Fünftel der Erdbevölkerung rund vier Fünftel der materiellen Ressourcen verbraucht. Dies hat zur Folge, dass die "Reichen" effektiv mit vierfachem Gewicht, die "Armen" jedoch nur mit einem Viertel Gewicht gezählt werden dürfen, womit umweltwirksam eigentlich vier Milliarden "Reichen" nur eine Milliarde "Arme" gegenüberstehen. Gut, sagen hier viele, aber wie wird dies in Zukunft aussehen? Werden nicht alle diese armen Menschen danach streben, den Lebensstandard der Menschen in den industrialisierten Ländern zu erreichen? Mag sein, dass sie dieses anstreben, aber wie soll das gehen? In 40 Jahren hieße dies doch, dass den dann biologisch 9 Milliarden Menschen effektiv 36 Milliarden heutige Durchschnitts-Umweltverbraucher entsprechen. Um sie zu unterhalten, würde dies wohl sechs weitere "Erden" erfordern, die wir nicht haben. Wir müssen "realistisch" davon ausgehen, dass sich - ohne tiefgreifende Eingriffe - der augenblickliche Trend einfach fortsetzen wird. Dies bedeutet aber, dass die etwa 8 Milliarden Menschen der armen Länder im Durchschnitt keine wesentlichen Fortschritte bezüglich ihres materiellen Wohlstandes erzielen werden. Infolgedessen wird die effektive Zahl der Umweltverbraucher bei den "Armen" bestenfalls nur wie die biologische zunehmen, also auf zwei Milliarden Umweltkonsumenten ansteigen. Doch wie steht es mit den in 40 Jahren dann 1,35 Milliarden Menschen in den reichen Ländern? Entsprechend ihrem ungebrochenen Glauben an die Notwendigkeit eines stetigen Wirtschaftswachstums werden sie eine jährliche Zunahme von zwei bis drei Prozent zu erreichen suchen und dies vielleicht auch durchsetzen. Da ein solches Wachstum dominant mit einem entsprechenden Umweltverbrauch gekoppelt sein wird, führt dies zu effektiv etwa 15 Milliarden „Umweltkonsumenten". denen gegenüber die zwei Milliarden der Armen kaum ins Gewicht fallen werden. Selbstverständlich ist auch dieses Szenarium gänzlich irreal. Denn wegen der Endlichkeit unserer Erde, ihrer beschränkten Quellen und vor allem Senken, muss und wird diese Entwicklung katastrophale Formen annehmen, die zu schildern einer Zeitschrift "Contra Zukunft" vorbehalten werden sollte. Die zunehmende Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen erwächst also vornehmlich aus dem immer weiter anwachsenden Verbrauch an materiellen Ressourcen im Norden. Er wird dazu durch den steigenden Verbrauch an nicht-erneuerbaren Energieträgern, vor allem Erdöl, Kohle und Erdgas, angetrieben. Wenn wir aufrichtig an die in unseren Sonntagsreden wortreich beschworene "humane" Gesellschaft glauben, dann müssen wir uns an den Werktagen auch um eine "ökologisch nachhaltige, gerechte und lebenswerte Welt kümmern und entsprechend handeln. Dies kann nur heißen, dass wir versuchen, alle Menschen angemessen an den Gütern und Früchten dieser Erde teilhaben zu lassen. Wegen der endlichen Belastbarkeit der Erde steht jedem Menschen dann eigentlich nur ein beschränktes Öko-Budget zur Verfügung, das wesentlich durch das Budget an Primärenergie bestimmt ist. Eine grobe Abschätzung ergibt, dass bei den jetzigen über fünf Milliarden Menschen auf der Erde bei Gleichbehandlung aller, jeder Person, im Schnitt nur ein Primärenergieverbrauch von 1,5 Kilowattstunden pro Stunde oder 13000 Kilowattstunden pro Jahr zur Verfügung steht. Dies ist etwa ein Viertel des Verbrauchs eines Westeuropäers, ein Siebtel von dem eines US-Amerikaners und das Zwanzigfache von dem eines Bangladeschi. Diese Zahlen sollten uns als grobes Maß für die Entwicklung umweltverträglicher Lebensstile dienen. Auf Europa angewandt würde ich vermuten, dass die von uns geforderte Viertelung unseres Energieverbrauchs zur Hälfte durch technische Neuerungen, eine weitere Halbierung aber nur durch geeignete Änderungen unseres Lebensstils erreicht werden kann. Aufgrund historischer Erfahrungen erscheint dies zunächst hoffnungslos. Doch: Die Zukunft ist offen. Handeln wir also so, als ob noch alles möglich wäre.