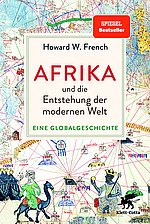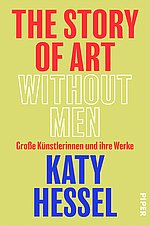Johann Hari verfolgt ein ambitioniertes Anliegen. Er möchte mit diesem Buch weite Teile unseres (Alltags-)Wissens über Drogen als falsch entlarven. Unsere Perspektive auf das Phänomen der Abhängigkeit – egal ob substanzgebunden oder -ungebunden – entspricht nicht der Realität. Aber nicht nur das; durch unser verzerrtes und auch ideologisch getrübtes Bild, führt auch die Drogenpolitik meist in die Irre. Auf die Frage, warum das so ist, gibt dieses Buch umfassend und zugleich detailliert Antwort.
Unsere Kultur stellt uns eine „Geschichte“ darüber zur Verfügung, wie Abhängigkeit funktioniert. Durch die Einnahme von Substanzen verändern sich chemische Abläufe in unserem Gehirn, die wiederum unser psychisches Erleben, unsere Gefühle und unser Wohlbefinden beeinflussen. Nach wiederholtem Konsum kommt es bald zu einem Gewöhnungseffekt, der schlussendlich in einer psychischen und/oder körperlichen Abhängigkeit mündet. Unsere Gesellschaft findet auf diese „Erzählung“ ein „Gemisch“ von Antworten, die für abhängige Personen sowohl Mitleid und therapeutische Maßnahmen als auch moralische Verachtung und Bestrafung bereithält. Aus nachvollziehbaren Gründen kann jedoch diese „Erzählung“ nicht oder nur teilweise stimmen. Denn Personen, die z. B. aufgrund einer Operation oder einer Erkrankung Morphium verschrieben bekommen, haben ein viel geringeres Risiko abhängig zu werden. Außerdem ist erwiesen, dass Soldaten, die im Krieg eine Vielzahl von Drogen zu sich nahmen, nicht zwingend eine Abhängigkeit entwickelten. Kurz gesagt, „kann [man] über einen langen Zeitraum Drogen nehmen, ohne süchtig zu werden“ (S. 192). Für die Entwicklung einer Sucht muss es daher noch andere, „dahinterliegende“ Ursachen geben.
Umfassendes Verständnis von Abhängigkeit
Laut Hari bleibt in den vielen Theorien über Abhängigkeit das Gesellschaftliche und Soziale unberücksichtigt. Dies kann anhand von zwei paradigmatischen Tierexperimenten verdeutlicht werden: Im ersten von Hari geschilderten Experiment wurden Ratten oder Mäuse wiederholt in Käfige gesteckt, in denen die Tiere ihren Durst entweder mit Wasser oder mit einer mit Drogen durchsetzten Flüssigkeit löschen konnten. Entsprechend der skizzierten „Alltagstheorie“ zeigte sich, dass die Tiere nahezu unkontrolliert das mit Drogen versetzte Wasser zu sich nahmen, und zwar häufig so lange, bis sie daran zugrunde gingen. Dieser Versuchsanordnung stellt Hari ein weniger prominentes Experiment entgegen. Der kanadische Wissenschafter Bruce Alexander setzte die Ratten in einer ihnen neuen Umgebung aus. Anstatt die Tiere von anderen Ratten zu isolieren, errichtete er einen ganzen „Rattenpark“, in dem die Tiere gemeinsam mit ihren Artgenossen spielen und in Austausch treten konnten. In diesem Setting geriet das mit Drogen versetzte Wasser zur Nebensache. Daraus schließt Hari, dass Sucht nur in den wenigsten Fällen eine Erkrankung ist, die direkt durch eine Substanz und ihren Wirkungen verursacht wird. Vielmehr postuliert er, dass Sucht in der Regel als ein „Gebrechen“ aufgrund von Einsamkeit zu verstehen ist (vgl. S. 212). Für ein umfassendes Verständnis von Abhängigkeit müssen daher vermehrt jene familiären und gesellschaftlichen Bedingungen in den Fokus gerückt werden, die Menschen vereinzeln und vereinsamen lassen. Sucht ist, so verstanden, als ein „fehlgeleitetes“ Bindungsverhalten zu verstehen, mit der das Fehlen „echter“ Bindungen kompensiert wird. Das heißt, „[c]lean ist nicht das Gegenteil von Sucht. Das Gegenteil ist, nicht allein zu sein.“ (S. 354)
Diese beschriebene Perspektive hat direkte Implikationen auf den Umgang mit Drogen und in weiten Teilen auch auf die Drogenpolitik. Die Geschichte der Drogen ist seit langer Zeit eine kriegerische; eine Geschichte, die bisher vorwiegend nur eine Antwort kannte, und zwar jene der Repression. Der „war on drugs“ brachte vor allem in Amerika, wo dieser Krieg bis heute am härtesten geführt wird, keine Verbesserungen; im Gegenteil: das Geschäft mit den Drogen floriert nach wie vor. Hari konstatiert außerdem, dass ein moralisierender und repressiver Umgang mit Sucht und süchtigen Personen die Probleme lediglich verstärkt. Denn ein solcher folgt der paradoxen Idee, man könne dem Leid abhängiger Personen begegnen, indem man ihnen – etwa durch Strafen – noch mehr Schmerz zufügt. Auch dem oft geforderten Verbot von Drogen kann Hari nur wenig abgewinnen, denn ein striktes Verbot spielt dem Geschäft der Dealer und Drogenbarone in die Hände und macht es lukrativ. Nur eine liberale Drogenpolitik, wie z. B. jene in Portugal, kann dem Schwarzmarkt den Garaus machen. Es ist eine ideologisierte, repressive Politik, ein „Prohibitionismus“, der zu einer unheilvollen Verquickung von Verbrechen und Politik führt. Denn „[d]as Drogenverbot rief sie“, die Verbrecher, „ins Leben, da diese Politik sie braucht. Und es wird sie geben so lange es das Drogenverbot gibt.“ (S. 76)