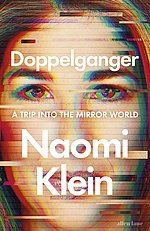Nikolaus Dimmel ist Arbeitsrechtler an der Universität Salzburg mit Schwerpunkt „Soziale Grundsicherung“. Die von Alfred J. Noll und Dominik Öllerer herausgegebene „Festgabe“ zum 60. Geburtstag des Jubilars enthält neben österreichspezifischen Beiträgen, etwa zur Verschärfung der Mindestsicherung, auch grundsätzliche Überlegungen zur Veränderung der Sozialpolitik in Zeiten des Neoliberalismus.
Über Konsumgesellschaft und die Entstehung des Wohlfahrtsstaates
Tom Schmid ruft die Entstehung des Wohlfahrtsstaates im Kontext des fordistischen Produktionsregimes und dessen Erosion im Gefolge der weltpolitischen Wende 1989 in Erinnerung. Die Linke habe ihre utopische Energie verloren, geblieben sei die rückwärtsgewandte Utopie des Nationalismus der Rechten. Die progressiven Kräfte könnten, so Schmid, nur dann erneut reüssieren, wenn es ihnen gelingt, einen „Diskurs von der Sicherheit der Vielfalten“ (S. 47) anzustoßen, ein Diskurs, der soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechte umfassen müsse. „Zukunftsoptimismus bleibt, denn Diversitäten, Unterschiede und Vielfältigkeiten, die keine Angst (mehr) machen, ermöglichen eine neue Geborgenheit in den Vielfältigkeiten – die freilich anders aussehen wird als die biedermeierliche Geborgenheit im scheinbar Unpolitischen.“ (S. 49)
Dem Begriff der „Konsumgesellschaft“ spürt Johann J. Hagen nach, wobei er damit die umfassende Kommerzialisierung, das „Ineinander-Fließen von Kultur und Konsum, von Information, Werbung, Unterhaltung, Sport, Politik und Wirtschaft“ zum Ausdruck bringt. Die Konsumentinnen und Konsumenten würden damit selbst zu Waren, Konsum sei so gesehen alles, „was den Marktwert des Konsumenten erhöht“ (S. 118). Spannend ist auch Hagens Frage, warum überhaupt von Konsumgesellschaft gesprochen wird, „und nicht von Arbeitsgesellschaft, Profitgesellschaft oder kapitalistischer Gesellschaft?“ (S. 104).
Über Hauseigentum und kulturelles Kapital
Dass eine „Gesellschaft von HauseigentümerInnen“ der Entsolidarisierung Vorschub leiste (bei einer lediglich trügerischen Vorstellung von Sicherheit), versucht der Reichtumsforscher Martin Schürz nachzuweisen. Eigentum an der Wohnimmobilie sei, vom Volumen betrachtet, eine wichtige Komponente des Nettovermögens: „Aber Ihr Kennzeichen ist, dass sie die Vermögenskomponente der oberen Mitte ist.“ (S. 122) Für jene unterhalb der Mitte sei es schwer bis unmöglich, Wohneigentum zu erwerben. Die Idee, jeder solle Privateigentum anstreben, hält Schürz daher für problematisch; sie untergrabe zudem das „Wirgefühl der Solidarität“, da in dieser Denkweise jeder nur auf sich und sein Fortkommen schauen müsse. Die Eigentümergesellschaft sei „ein Gegenprojekt zum Wohlfahrtsstaat“ (S. 125). Eine Meinung, die sicher zu diskutieren ist. Laut Schürz könne nur sozialer Mietwohnbau die Wohnungsfrage lösen. Ein hoher Anteil an Mieterinnen und Mitern, wie er in Österreich (v. a. in Wien) gegeben ist, ermögliche die Haushaltsgründung jüngerer Menschen und biete auch die gebotene Flexibilität am Arbeitsmarkt, bei der Arbeitssuche und Fortbildung.
Barbara Mair zeigt mit Bezugnahme auf Bourdieu u. a. auf, wie kulturelles Kapital vererbt wird – und zwar nicht nur im Sinne vererbter Bildungskarrieren (was empirisch mehrfach belegt ist), sondern auch durch „Transmission von Wertorientierungen“ (S. 96) wie Leistungsbereitschaft, Zukunfts- oder Selbstvertrauen. Dieses „soziale Erbe“ sei in der Sozialforschung zu Unrecht eher vernachlässigt worden, so Mair. Auch wenn das Fundament von sozialstrukturellen und sozialökonomischen Faktoren von Armut nicht in Zweifel gezogen werden soll, sei „die Weitergabe von kulturellen Elementen wie Werten, Normen und Einstellungen von einer Generation zur nächsten doch gewissermaßen Voraussetzung und Grundlage dauerhafter Armut“ (S. 100).
Rudolf Mosler über ein Neudenken von betrieblicher Mitbestimmung
Ausgehend von der historischen Genese des österreichischen Systems der Betriebsräte, das 1919 als Konzession an die damals revolutionäre Situation in vielen europäischen Staaten, so auch in Österreich, grundgelegt wurde, fragt der Arbeitsrechtler Rudolf Mosler, wie betriebliche Mitbestimmung im Kontext von Digitalisierung, Crowdwork, virtuellen Arbeitsstätten und Homeoffice neu gefasst werden müsse. Er plädiert für eine Änderung des Arbeitnehmerinnen- bzw. Arbeitnehmerbegriffs, erweiterte Betriebsvereinbarungskompetenz in Kooperation mit den Gewerkschaften sowie einen Ausbau des Europäischen Betriebsverfassungsrechts. Die Interessensvertretung im Betrieb werde, so Mosler, durch Globalisierung, Digitalisierung und die weltweite Verschiebung der Machtverhältnisse schwieriger. Trotzdem oder gerade deswegen sei die „gesetzliche Betriebsverfassung nicht überflüssig geworden“ (S. 150).
Über Rebellion und Scheindemokratie
Welche Bedingungen für Revolte und Aufstand gegeben sein müssen, referiert Mitherausgeber Alfred J. Noll an einer Schrift von Thomas Hobbes aus dem Jahr 1640 („Elements of Law Natural and Politic“). Neben Unzufriedenheit und dem Gefühl im Recht zu sein bzw. dass einem Unrecht geschehe, brauche es zur Rebellion auch die Hoffnung auf Erfolg (weil sonst die Guillotine oder zumindest das Gefängnis drohe). Zu dieser gehörten eine einvernehmliche Haltung der Unzufriedenen, eine genügend große Anzahl von zur Revolte Bereiten sowie die Einigung auf eine Führungspersönlichkeit (Hobbes fügt auch den Besitz von Waffen hinzu). Noll überlässt es den Leserinnen und Lesern, Schlüsse auf die Jetzt-Zeit zu ziehen, betont aber, dass Unzufriedenheit und das Gefühl von Unrecht erst dann zu einem „gesellschaftlichen Akteur“ werden können, wenn ihr hoffnungsvoller Veränderungswille sich in einem „Stellvertreter ihres Leidens“ und andererseits als „Propagandist ihrer Hoffnungen“ (Zitate Hobbes) verkörpert – nach Noll sei damit nicht nur eine Führungspersönlichkeit gemeint, es könne auch eine politische Partei diese Aufgabe übernehmen. Welche das heute wäre und ob die Unzufriedenheit in unserer „Konsumgesellschaft“ (s. o.) überhaupt genügend stark für eine Rebellion sei, lässt der Autor offen.
Der zweite Herausgeber Dominik Öllerer widmet sich dem von Colin Crouch geprägten Begriff der „Postdemokratie“ als Scheindemokratie, in der zwar weiterhin Wahlen stattfänden, die Entscheidungen aber durch Wirtschaftslobbying fallen würden. Öllerer weitet Postdemokratie aus: er bezieht sie auf die „mediadisierte Spaßgesellschaft“ (S. 210), die Entpolitisierung der Politik sowie die „Ökonomisierung des Sozialen“, durch die „jeder zum Garanten seiner eigener Gesundheit, Sicherheit und Vorsorge“ werde (S. 212). Zugleich kritisiert er die Aushöhlung des (nationalen) Rechts durch Freihandelsverträge, bei denen Rechtsfragen nicht mehr von Gerichten, sondern von internationalen Schiedsgerichten geklärt werden.
Über Illusionslosigkeit und strategische Intelligenz
Im wohl radikalsten Beitrag des Bandes widmet sich Klaus Firlei der Frage nach „strategischer Intelligenz“ und den „Voraussetzungen progressiver Gesellschaftsgestaltung“. Der Arbeitsrechtler und Vorsitzende des Kuratoriums der Robert-Jungk-Stiftung liefert mit „Illusionslosigkeit und strategische Intelligenz“ einen pointierten und tiefgehenden Text. Seine zentrale These: Wir brauchen ein „völlig anderes regulatives Setting, andere Spielregeln“ (S. 221), insbesondere gehe es dabei um die Wirtschaftsverfassung, die politische Verfassung und das Verhältnis von Mensch und Staat.
Den zahlreichen zivilgesellschaftlichen NGOs sowie den „linken“ Bewegungen wirft Firlei ein Strategie- und Theoriedefizit vor: Die „veränderungswilligen“ progressiven Kräfte verfügten über „sehr viel emotionale Energie, unübersichtlich viele Zukunftsvisionen, viele Bekenntnisse und Manifeste aller Art, aber kaum über eine überzeugende Strategie“ (S. 221). Bewusstsein schaffen, Widerstand leisten, sich empören, Druck von unten erzeugen, sei zu wenig. Vielmehr gehe es darum, Antworten darauf zu finden, „wie Macht generiert werden kann, wie eine Verfassung aussehen muss, die die tödliche Systemdynamik des heutigen Kapitalismus außer Kraft setzt“ (S. 223). Firlei kritisiert an den progressiven Kräften auch die „verklärte Sicht auf den Menschen“ (S. 223) und das „Urvertrauen in die Vernunft- und Regierungsfähigkeit der Massen“ (S. 224). Und er glaubt nicht an die aus der Vielfalt an Initiativen und Diskursen „emergierende Zukunft“ (S. 224) gleich der „invisible hand“ des Marktes.
Was wäre also zu tun im Sinne strategischer Intelligenz? Als erstes empfiehlt Firlei Illusionslosigkeit im Sinne einer „eiskalten Dusche der Rationalität“ (S. 225). Die Zeiten, in denen die Interessen und Kräfteverhältnisse klar abzustecken waren, seien vorbei. Das Kapital entfalte sich zunehmend in einem „Raum ohne Politik“ (S. 226), die Staaten stünden in einem brutalen Standortwettbewerb, der Faktor Arbeit als „mächtigste Gegenkraft mit realer Power“ (S. 226) werde ausgefranst und marginalisiert, die ökologische Zerstörung schreite rasant voran, die Abhängigkeit von den Produkten des Kapitals sowie der neuen Technologien sei enorm und beinahe unumkehrbar. Schließlich gebe der Kapitalismus vor, „die Menschen zu lieben“ (S. 227), indem er alle existenziell wichtigen Güter anbietet.
Reformen seien, so Firleis zweite zentrale These, immer schwerer durchzusetzen: „Einfache und plausible Forderungen, wie z. B. angemessene Mindestlöhne, die Abwendung einer Klimakatastrophe oder auch nur die Einhaltung von Grundprinzipien des Marktes (Kostenwahrheit, faire Wettbewerbsverhältnisse) sind vom System nicht mehr erfüllbar, daher per se ´systemüberwindend´ bzw. tendenziell ´revolutionär´“. (S. 227) Dazu komme der „Mensch als Teil des Kapitalverhältnisses“ (S. 228) in seiner Abhängigkeit und Verstrickung, der „auf sich selbst zurückgeworfen, nicht dazu in der Lage [ist], in einem integralen Sinne vernünftig zu handeln“ (S. 230). Der Staat sei demnach nicht nur in der Geiselhaft des Kapitals, sondern auch in der Hand von Wählern, „die mehrheitlich kein qualitatives Wachstum, kein Verbot von liebgewonnenen Konsumgewohnheiten, keine Einschränkungen ihrer Mobilität“ (S. 233) wollen. Die systemerhaltende Macht sei nicht mehr repressiv, sondern seduktiv, „das heißt, verführend“ (S. 233), das Programm des Kapitalismus die „Zertrümmerung einer strukturierten Gesellschaft zugunsten einer amorphen Menge entbetteter Individuen“ (S. 232).
Wo sieht Firlei nun den Ausweg aus seiner gezeichneten Dystopie? Er plädiert für eine „politisch-ökonomische und kulturelle Formation, die geprägt ist durch eine staatliche Regulierung der Produkt- und Technikentwicklung, durch eine globale und europäische Gesetzgebung, durch Bedarfsdeckung in den Feldern von Kultur, Wissen und Bildung statt hedonistischem Konsumismus“ (S. 234). Die geltende Verfassungsordnung auf nationaler wie EU-Ebene, die den freien (Binnen-)Markt und die Eigentumsgarantie festschreiben, erlaube dieses ökonomische Mischsystem aus Markt und Staat, das „dem Staat und kollektiver Gegenmacht eine dominierende Rolle zuweist“ (S. 235), jedoch nicht. Auch staatlich subventionierte Wirtschaftssektoren seien untersagt. Man würde daher in den EU-Verträgen eine „Transformationsklausel“ brauchen, die eine gemischte Wirtschaft ausdrücklich zuließe. Deren Realisierungschancen lägen „allerdings bei null“ (S. 237).
„Wir fahren mit hohem Tempo gegen die Wand. Eine Wende ist äußerst unwahrscheinlich“ (S. 237), so Firlei abschließend. Der Ausweg würde für ihn in einer Weltverfassung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse liegen, die über die privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Rechtsakte von Einzelpersonen hinausweist: „Der Planet würde damit politisch und ökonomisch zu einer steuerungsfähigen Einheit, was die sich der Menschheit objektiv stellende Aufgabe der heutigen Epoche ist.“ (S. 238) Die Menschheit gewänne an Regierungsfähigkeit, der Einzelne und die Nationen verlören an autonomer Gestaltungsmacht.
Firleis Beitrag spricht grundsätzliche Fragen an. Wie es aussieht, ist die Megamaschine Kapitalismus nicht zu stoppen. Ihre Attraktivität könnte zugleich ihr Verderben werden. Alle internationalen Vereinbarungen von den Klimaabkommen bis hin zu den Sustainable Development Goals leiden – so richtig und wohlklingend ihre Absichten sind – an der fehlenden Rechtsverbindlichkeit mit den entsprechenden Sanktionsmechanismen. Die Stärke offener Gesellschaften (und die Weltgesellschaft wächst durch die globalen Wissensnetzwerke in diesem Sinne trotz aller Fragmentierungen auch zusammen) liegt jedoch in der Fähigkeit, Probleme zu erkennen und nach neuen Lösungen zu suchen. Im Zusammenwirken von zivilgesellschaftlichen Initiativen einschließlich sich erneuernder Gewerkschaften, sich organisierenden Kommunen (etwa im bereits bestehenden „Weltparlament der Städte“), internationalen Vereinigungen aus Wissenschaft, Bildung und Kultur, der „Weltkonferenz der Religionen“, nicht zuletzt neuen politischen Führungspersönlichkeiten (wie der neuseeländischen Premierministerin oder der neuen finnischen „Frauenregierung“) könnte der Umschwung und die von Firlei geforderten Änderungen der internationalen Rechtssysteme (etwa Umsetzung des „Verursacherprinzips“) im Sinne einer gesteuerten Globalisierung doch noch gelingen. Ebenso denkbar ist aber eine generelle Zurückdrängung der kapitalistischen Expansion, der Übergang zu Krisenanpassungs- und Resilienzstrategien, die erneute Rückkehr zu krisenfesteren regionalen Wirtschaftssystemen. Dies wäre kein rückwärtsgewandter politischer und bestimmte Menschengruppen diskriminierender Nationalismus, sondern eine strukturelle Neuordnung der Versorgungssysteme mit Marktwirtschaften anstelle des gegenwärtigen Raubtierkapitalismus. Der Weg dorthin entspräche einer Mehrebenen-Strategie: Transformationsprojekte an vielen Orten von Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und neuen Gemeinschaftsinitiativen „von unten“, neue politische Regulierungen auf nationaler und supranationaler Ebene „von oben“. Die Pandemie könnte ein Vorgeschmack auf weitere, größere Krisen sein, die das Neuordnen unserer Versorgungssysteme ohnedies erzwingen werden.