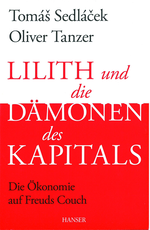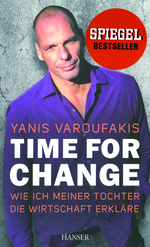Knapp 3 Billionen US-Dollar mussten die Banken weltweit aufgrund der Finanzkrise, beginnend mit der Pleite von Lehmann Brothers, abschreiben – eine beinahe unvorstellbare Summe! Der Ökonom Ulrich Mössner hilft daher mit einem augenscheinlichen Vergleich nach: „Um nur eine Billion Dollar zu erreichen, müssten nicht nur Sie, sondern auch Ihre Vorfahren bereits über 20.000 Jahre hindurch wöchentlich eine Million Dollar im Lotto gewonnen haben.“ (S. 32) Dass diese Verluste nicht zum Zusammenbruch des gesamten Wirtschaftssystems geführt haben, hängt damit zusammen, dass sich der Finanzsektor vom Realwirtschaftssektor immer mehr entkoppelt, sozusagen ein Eigenleben zu führen begonnen hat.
Mössner verweist auf die Schuldenfalle, die er insbesondere in den USA ausmacht („Ein Land lebt über seine Verhältnisse“), aber auch Europa erfasst habe. Die Maastricht-Grenze von 60 Prozent des BIP werde mittlerweile von fast allen EU-Ländern deutlich überschritten. Griechenland sei hier nur ein besonders krasses Beispiel. Der Autor prognostiziert dramatische Folgen dieser „Verschuldungskrise“: „Wenn die Zinsen wieder steigen, und das werden sie, dann wird die steigende Zinslast die Haushalte strangulieren.“ (S. 42) Das Grundübel sieht (auch) Mössner in der neoliberalen Wirtschaftstheorie. Die Krise führt er auf vier Faktoren zurück: die Deregulierung der Finanzmärkte, überzogenes Gewinn- und Renditestreben, die dadurch ausgelöste Gier und eine „übersteigerte Wachstumsideologie“ (S. 48). In seinen Vorschlägen für eine „nachhaltige Marktwirtschaft“ deckt sich der Autor in vielem mit anderen, etwa in der Begrenzung von Einkommens- und Vermögensunterschieden oder mit der Einführung einer Finanztransaktionssteuer notfalls auch ohne „London“. Hinsichtlich einer „nachhaltigen Finanzwirtschaft“ sieht Mössner bislang nur wenig umgesetzt. Zentral erscheinen dem Autor ein Abbau der (europäischen) Schulden und die Abkehr vom exponentiellen Wachstum – im Mittel soll dieses in entwickelten Volkswirtschaften nicht mehr höher als 1 Prozent liegen (S. 177) Die Politik des „billigen Geldes“ müsse wieder zurückgefahren werden: „Lieber ein kleines, aber stabiles Wachstum als ein großes, aber sehr krisenanfälliges.“ (S. 180).
Überzogene Schulden?
Der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank Norbert Walter und Jörn Quitzau von der Berenberg Bank sehen im Rückbau der Schulden die zentrale Aufgabe der zukünftigen Wirtschaftspolitik, um wieder Vertrauen in die Märkte zu bringen. In „Wer soll das bezahlen?“ fordern sie eine auf Preisstabilität und strikte Inflationsbekämpfung ausgerichtete Strategie. Denn die Bedienung alter Schulden durch neue Schulden funktioniere nur, solange das Vertrauen in die prinzipielle Leistungsfähigkeit und Steuerkraft eines Landes vorhanden sei: „Griechenland hat ab Ende 2009 schmerzlich erfahren müssen, wie es ist, das Vertrauen an den Kapitalmärkten zu verlieren.“ (S. 273) Ein Staatsbankrott in der Eurozone könnte zu einer Panik unter den Anlegern führen, „die mit den Zuständen nach der Lehmann-Pleite vergleichbar wäre“ (S. 196). Die Autoren begrüßen daher den Rettungsschirm, das Prinzip „die Privaten machen die Gewinne, und der Steuerzahler haftet für die Verluste“ (S. 197), dürfe jedoch nicht zum Dauerzustand werden. Die privaten Investoren müssten schnellstmöglich für anstehende Verluste in Haftung genommen werden, was nur über eine „staatliche Insolvenzordnung“ möglich sei. „Die Investoren wüssten bei der Geldanlage, was auf sie zukommt.“ (ebd.) Und da die Kurse griechischer Staatsanleihen trotz Rettungsschirm um die Hälfte gefallen seien, war ohnedies „ein Schuldenschnitt um 50 Prozent eingespeist“ (ebd). Hinsichtlich Regulierung der Finanzmärkte bleiben die Autoren ambivalent. Diese könne das Vertrauen in die Finanzwirtschaft stärken, aber auch das Gegenteil bewirken: „Der Zwang zum Erlass von Regeln kann auch als Misstrauen verstanden werden.“ (S. 277) Nicht weniger wichtig sei daher das Zurückfahren der Verschuldung, da andernfalls mit der Gefahr der Gewöhnung ans Schuldenmachen zu rechnen sei, was letztlich in die absolute Krise führe. Oder im Bild des Finanzexperten Nassim Taleb: „Truthähne, die über Monate und Jahre von Menschen gefüttert werden, entwickeln Vertrauen und glauben deshalb, die Fütterung würde sich in der Zukunft fortsetzen – bis zu dem Tag, an dem sie geschlachtet werden.“ (S. 278) So enden die Autoren mit einem freilich fragwürdigen Appell an alle, die im Finanzsektor tätig sind, „freiwillig mehr zu liefern, als von den Regeln verlangt wird“. Denn die Basis für alles sei das Vertrauen der Bürger in die Arbeit all derer, „die unsere Wirtschaftsordnung für die vor uns liegenden Aufgaben neu gestalten“ (S. 277). Aber eben dieses Vertrauen wurde ja zuletzt stark erschüttert, wenn nicht zur Gänze verspielt!
Zuviel Sozialstaat?
Noch einen Schritt weiter geht der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther. Er heißt die staatlichen Rettungsmaßnahmen zur Abwendung der Finanzkrise zwar gut („Es drohte der Notstand als Gefährdung unseres öffentlichen Lebens“, S.8), fordert aber, dass sich nun der Staat wieder aus dem Finanzmarktgeschehen zurückziehen solle. Gläubiger sollten durchaus in die Pflicht genommen und mehr Risiken im Zusammenhang mit möglichen Staatspleiten übernehmen – auch Hüther fordert ein Staatsinsolvenzrecht, das Hauptproblem sieht der Ökonom jedoch im seit den 1970er-Jahren überbordenden Sozialstaat, der einem modernen „Leistungsstaat“ zuwider laufe. Die „Dominanz von Verteilungsthemen“ (S.11), die zum „Nachlassen fiskalischer Disziplin“ geführt habe (ebd.), müsse wieder gegenüber aktiver Bildungs- und Innovationspolitik zurückgedrängt werden, da nur diese Wachstum garantiere. Der Ökonom plädiert zwar für eine starke Finanzmarktaufsicht, fordert aber zugleich eine „Revision der Staatstätigkeit“ (S. 183), die wieder mehr Verantwortung des Einzelnen verlange. Die Zukunft des Euro hängt für Hüther vor allem davon ab, „Finanzpolitik und Geldpolitik zu objektivieren und aus dem gewöhnlichen Verteilungsstreit herauszunehmen“ (S. 182).
Neue Crashes?
Glaubt man Ulrich Mössner (s. o.), so sind die nächsten Krisen vorprogrammiert: „Die kurzfristige Rendite- und Gewinnmaximierung dominiert nach wie vor die Wirtschaft, angeheizt durch unvermindert hohe Boni und Tantiemen. Wachstum auf ´Pump´ ist immer noch die Devise. Das billige Geld der Notenbanken füllt schon die nächsten Blasen, die dann unversehens platzen werden.“ (S. 17)
Niall Ferguson, ein glühender Verfechter des Kapitalismus, gibt ihm dabei indirekt Recht. In seiner umfangreichen Analyse „Der Aufstieg des Geldes“, die grundsätzlich die Finanzmärkte als Produktivfaktor der Wirtschaft herausstellt, macht der Wirtschaftshistoriker der Harvard University deutlich, wie viele Finanzcrashes es seit Erfindung der Börsen vor einigen Jahrhunderten bereits gegeben hat. Das Besondere seiner Darstellung: In den meisten Fällen seien letztlich die Gläubiger die Dummen gewesen, da sie in den Krisen viel Geld verloren hätten – ein Befund, der freilich trügt. Denn die Vermögenden behalten viel, auch wenn sie viel verlieren. Doch die Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben bisher vor allem immer die einfachen Bürger gespürt, sei es durch Arbeitslosigkeit, schleichende Lohnentwertung oder höhere Steuern.
H. H.
Mössner, Ulrich: Das Ende der Gier. Nachhaltige Marktwirtschaft statt Turbokapitalismus. München: Ökom, 2011. 213 S., € 19,95 [D], 20,60 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-86581-275-9
Hüther, Michael: Die disziplinierte Freiheit. Eine neue Balance von Markt und Staat. Hamburg: Murmann, 2011. 187 S., € 19,90 [D], 20,50 [A], sFr 27,90
ISBN 978-3-86774-130-9
Ferguson, Niall: Der Aufstieg des Geldes. Die Währung der Geschichte. Berlin: List-Verl., 2011. 368 S. (2. Aufl.) € 14,95 [D], 15,40 [A], sFr 20,90
ISBN 978-3-548-60988-1