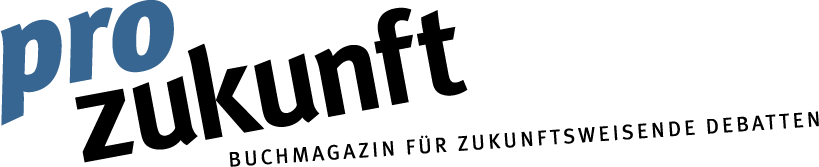Auch in der abschließend vorgestellten Publikation ist viel von den Möglichkeiten und Chancen der digitalen Demokratie die Rede. Wie diese in Deutschland zu gestalten wäre, wird hier in Form von Interviews, Analysen und persönlichen Statements beantwortet. Nicht zuletzt geht es um die Frage, wie wir die digitale Zukunft (mit)gestalten. Für die Herausgeber genügt es dabei allerdings nicht mehr, bestehende Strukturen und Systeme ein wenig auszubessern und zu erneuern. Vielmehr sei ein tatsächlicher Neustart, ein „rebooten“ des gesamten Systems notwendig. Der Zusatz D im Titel steht dabei für Deutschland, obwohl die Analysen und Bewertungen keineswegs auf Deutschland beschränkt sind. Grundsätzlich gilt den Autoren das Netz „als neuer politischer Raum, als Raum für lebendige Öffentlichkeit, als Raum „für das angeregte Stimmengewirr, für das kollektive Selbstgespräch“ (S. 27).
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Feststellung, dass sich in Deutschland Onliner und Off-liner gegenüber stehen. Deshalb wollen die Autoren eine Brücke zwischen der Internetgeneration und der Politik bauen. Viele Beiträge, so die Herausgeber, seien deshalb im Austausch zwischen beiden Gruppen entstanden. Neben vielen politikbegeisterten „Digital Natives“ haben namhafte (Netz-)Politiker wie Oswald Metzger, Thorsten Schäfer-Gümbel und auch Markus Beckedahl Beiträge geliefert. Ein Blick ins Ausland zeigt, wie in China (Isaac Mao) und in den USA (Tim O’Reilly) mit diesem Thema umgegangen wird.
Neben den überwiegend optimistischen Einschätzungen warnt hingegen Oswald Metzger von einer „Infantilisierung der Gesellschaft“, in der jede/r ohne eine redaktionelle Kontrolle veröffentlicht, was immer ihm/ihr gefällt. In den unendlichen Teilöffentlichkeiten des Netzes sei so die „echte Information“ nicht mehr zu erkennen. Es zeige sich vielmehr, dass die „Weisheit der Vielen“ nicht zwangsläufig dazu führt, dass alle Deutschen nun zu demokratischen Musterschülern einer neuen, aufgeklärten Bürgergesellschaft mutieren, meint Metzger.
Andererseits ließe sich allein mit mehr Transparenz des öffentlichen Apparates, so der Tenor eines Beitrags von Willi Kaczorowsky (Ciso), Partizipation und Engagement der Menschen enorm steigern. Dazu müsste, so ein Vorschlag, jedes Gesetzgebungsverfahren online gestellt werden, um die Möglichkeit zum nutzerfreundlichen Online-Diskurs durch die Netzgemeinschaft zu bieten. (vgl. S. 38). Wünschenswert sei aber auch die regelmäßige Durchführung von moderierten Online-Foren, der Ausbau des eVoting und ePetitionsrechts sowie die Möglichkeit des online-basierten Dialogs mit ParlamentarierInnen. Wie das gehen könnte, zeigt die US Administration mit dem „Open Government Dialogue“, mit dem eine neue Offenheitsstrategie initiiert wurde. In Deutschland hat das Bundesinnenministerium angekündigt, „dass die nächste föderale eGovernment-Gesamtstrategie im interaktiven Dialog entstehen soll“ (S. 39). Ziel ist eine neue Politik im Sinne des „open Book Government“, bei dem durch intelligente Aufbereitung der Daten in Echtzeit ein vollständig transparenter Überblick über die finanzielle Situation des täglichen Regierungs- und Verwaltungshandelns möglich sein soll. Gleichzeitig stellt dies jedoch eine Hürde dar, denn die Bereitschaft zu umfassender Transparenz ist – man denke etwa nur an dieUmsetzung der EU-Richtlinie zur Offenlegung der Agrarsubventionen – nicht eben ausgeprägt.
Partizipation im Netzwerk
Zwar sind die Zeiten, in denen Strategien von Eliten in abgeschlossenen Zirkeln und Sitzungszimmern erarbeitet und der erstaunten Öffentlichkeit verkündet werden, vorbei. Aber die gegenseitige Skepsis ist nach wie vor ein Thema. In einem Interview sagt Peter Kruse, Managementberater und Psychologe, dass er sich nicht sicher ist, ob die Politik partizipativen Aktivitäten überhaupt traue: „Manchmal habe ich den Eindruck, man unterstellt lieber allgemeine Politikverdrossenheit als sich dem Risiko einer ehrlichen und taktisch nicht kalkulierbaren Auseinandersetzung zu stellen – sowohl bei der parteiinternen Kommunikation als auch in Richtung Öffentlichkeit.“ (S. 57) Aber auch er sieht keine Alternative zu mehr Partizipation, und ist davon überzeugt, dass die Netzwerke dazu phantastische Möglichkeiten bieten (vgl. S. 59).
Wie der switch von offline zu online gelingen kann, zeigen Erfahrungen aus einem kommunalen Gemeinschaftsprojekt in einer innovativen Gemeinde im Südosten von Bayern, wobei auch hier die Schwierigkeiten und Widerstände deutlich werden. Als eine mögliche Brücke zwischen Politik und User stellt Patrick Brauckmann das Web-Monitoring vor, mit dessen Hilfe sich Politik nicht länger von Meinungsbildungsprozessen im Internet abkoppelt.
Alles in allem zeigt sich: Ob Neustart oder Flickwerk, die digitale Demokratie steht erst am Anfang. Das Buch, online unter Netzbedingungen entstanden, enthält leider sehr viele editorische Mängel, die zweifellos der raschen Produktion geschuldet sind. Es kann übrigens auch kostenlos unter www.netzpolitik.org heruntergeladen bzw.online angesehen werden. A. A.
Reboot_D – Digitale Demokratie. Alles auf Anfang! Hrsg. v. Hendrik Heuermann … Neckarhausen: whois Verl., 2009. 244 S., € 24,80 [D], 25,50 [A], sFr 42,50
ISBN 978-3-934013-01-8