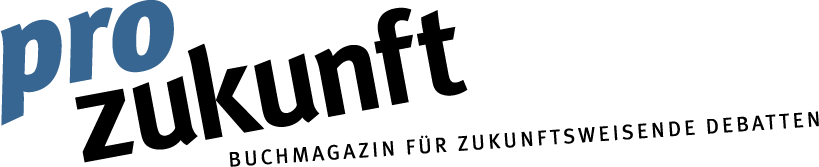Die in gut vier Jahren vor allem im deutschen Sprachraum zu einem anerkannten Akteur einer „anderen Globalisierung“ gewachsene „Global Marshall Plan Initiative“ setzt sich, kurz gesagt, für die Umsetzung der im Jahr 2000 von mehr als 189 Staaten beschlossenen UN-Millenniumsziele und die Entwicklung eines neuen Weltordnungsrahmens auf Basis einer ökosozialen Marktwirtschaft unter Einbindung der maßgeblichen globalen Akteure wie WTO, IWF, UN ein. Ihr Ziel ist die Sicherstellung einer nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung weltweit. Die dafür erforderlichen Geldmittel – rund 100 Mrd. $ jährlich von 2008 – 2015 sind errechnet, sollen durch ein überzeugendes Finanzierungskonzept (Steuern auf Devisen, transnational gehandelte Güter und Kerosin) aufgebracht werden. Die Resonanz ist überwiegend positiv und reicht von der politisch beschlossenen (aber vorerst wenig konkreten) Unterstützung durch Gebietskörperschaften (etwa acht österreichische Bundesländer) über Studenten- und Wirtschaftsverbände, NGOs und Kirchen bis hin zu vielen Einzelpersonen und in diversen kommunalen Gruppen tätigen AktivistInnen.
Zwei grundsätzliche strategische Aspekte des GMPI-Konzepts sind trotz dieser positiven Bilanz m. E. noch nicht beantwortet: Zum einen bleibt vorerst offen, ob und wie die maßgeblichen globalen Akteure als Partner des unumgänglichen Paradigmenwechsels gewonnen werde können. Überaus ambitioniert in diesem Zusammenhang ist ein kürzlich initiierter Konsultationsprozess, der darauf abzielt, in wenigen Monaten weltweit hunderte Entscheidungsträger für das Projekt zu gewinnen. Zum zweiten, und nicht minder wichtig, stellt sich grundsätzlich die Frage, was „der/die Einzelne“ zur Umsetzung des Anliegens beitragen kann.
Aus Sicht des Landes Oberösterreich will die hier angezeigte Broschüre dazu Anregungen geben und Impulse setzen. Die Neuordnung der Welt – so die zentrale Botschaft – geht von uns allen aus, fordert jede/n Einzelnen und äußert sich in unserem täglichen Handeln. Solidarität gegenüber den Mitbürgern zu üben, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber Freunden, in Unternehmen, in der Schule, bei der Bildungsarbeit oder in den regionalen Medien zum Thema zu machen, kann dazu ebenso beitragen wie die Hinterfragung des eigenen Lebensstils: Was ist mir wirklich wichtig? Kann ein Weniger an Gütern nicht ein Mehr an Sinn und Zeit bedeuten? Mit wem kann und will ich teilen? Von der ethisch bewussten Geldanlage über den Kauf fair gehandelter und biologischer Nahrungsmittel bis hin zur kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem Thema (gesichert etwa durch das „Buch-Paket“ im Rahmen der GMPI-Mitgliedschaft), die Organisation von Veranstaltungen oder die Mitwirkung in einem Kreis von Gleichgesinnten: Die Palette der Möglichkeiten wird prägnant und motivierend präsentiert. Hinweise auf Personen, Initiativen, Links, Literatur und einschlägige Zeitschriften runden die Darstellung ab.
In Anbetracht jeweils beschränkter persönlicher Kapazitäten und vermeintlich geringer Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich natürlich darüber diskutieren oder streiten, inwieweit persönlicher Einsatz die Welt verändert. Auch wenn, oder vielmehr weil wir die Antwort darauf nicht kennen, lohnt das Engagement, weil es die Möglichkeit der Verränderung wahr- und ernst nimmt. Dazu gibt die Broschüre viele Anregungen. Wünschenswert und mit vergleichsweise geringen Mitteln auch umzusetzen wäre die Adaptierung auch für andere (Bundes)Länder und Regionen. W. Sp.
Global Marshall Plan und Agenda 21. Maßnahmen und Aktionen für Gemeinden und Regionen. Hrsg. v. Verein Leb’s Net’s 21 und der SPES-Akademie (Panoramaweg 1, A-4553 Schlierbach)
www.spes.co.at