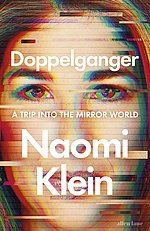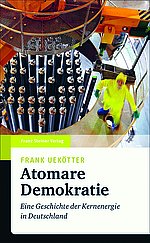„Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt.“ (S. 8) Damit beginnt Hartmut Rosa seine Essays über „Unverfügbarkeit“, entstanden im Rahmen einer Vorlesung an der Akademie Graz mit dem Literaturhaus Graz. Eine „Soziologie der Weltbeziehung“ (S. 11) zu entwickeln, ist das Ziel von Rosa (vgl. dazu auch den Suhrkamp-Band „Resonanz“). An zahlreichen Alltagsphänomenen wie der Optimierung unserer Körper, der Anhäufung von Terminen, die zur „Abarbeitung von explodierenden To-Do-Listen“ (S. 13) führt, oder dem Wunsch nach Einverleibung der Welt („das muss man mal gesehen haben“, ebd.) zeigt Rosa diesen Zwang zum Immer-Mehr. Er ist dabei um pointierte Formulierungen nicht verlegen: „Berge sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu fotografieren.“ (ebd.)
Der Einverleibungszwang
Zwei Thesen stellt der Autor diesem Einverleibungszwang voran. Das Steigerungsspiel der Moderne sei nicht vom Verlangen nach Höher, Schneller, Weiter, sondern von der Angst vor dem Immer-Weniger getrieben: „Wann und wo immer wir anhalten oder innehalten, verlieren wir an Grund gegenüber einer hochdynamischen Umwelt, mit der wir überall in Konkurrenz stehen.“ (S. 15f.). Damit rekurriert Rosa auf den modernen Kapitalismus, dem das Konkurrenzprinzip gleichsam in die Gene geschrieben ist. Eine Gesellschaft sei modern, „wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, das heißt, wenn sie zur Aufrechterhaltung ihres institutionellen Status quo des stetigen (ökonomischen) Wachstums, der (technischen) Beschleunigung und der (kulturellen) Innovierung bedarf“ (S. 15). Was der Ökonom Joseph Schumpeter mit „kreativer Zerstörung“ als Stärke des Kapitalismus beschrieb, weil daraus immer Neues entstehe, wird bei Rosa zum Zwang, der es uns verunmögliche, in tatsächliche Beziehung zur Welt zu treten. Dies führt zur zweiten These: der Verheißung der permanenten „Weltweitenvergrößerung“ (S. 16), die mit der Attraktivität des Geldes zusammenhänge: „Wie viel wir in Reichweite haben, lässt sich unmittelbar an unserem Kontostand ablesen.“ (S. 17)
Das Steigerungsversprechen
Steigerungsversprechen bestimmen – so Rosa – auch das Feld der Politik. Wer eine Wahl gewinnen möchte, muss „mehr Jobs, höhere Renten, bessere und billigere Wohnungen, schnellere Verkehrsverbindungen, schönere Schulen“ (S. 23) in Aussicht stellen. Und diese Politik sei immer imperialistisch: „Macht manifestiert sich stets in der Ausdehnung der eigenen Weltreichweite, oft auf Kosten anderer.“ (S. 24) Die Kehrseite dieses Expansionismus sieht Rosa mit frühen Soziologen und Philosophen wie Marx oder Durkheim im „rätselhaften Zurückweichen der Welt“ (S. 25), also der Entfremdung des Menschen sowie der Errichtung von Mauern, also der Abschottung. Die Depression sei nun jener Zustand, „in dem uns alle Resonanzachsen stumm und taub geworden sind, (...) dass uns nichts berührt und wir zugleich das Gefühl haben, niemanden mehr erreichen zu können.“ (S. 41)
Resonanz in vier Aspekten
Resonanz beschreibt Rosa in vier Aspekten: dem Moment der Berührung (Affizierung), der Selbstwirksamkeit (Antwort), der Anverwandlung (Transformation) sowie eben der Unverfügbarkeit (S. 38ff.). Das führt ihn wiederum zur Kritik an der kapitalistischen Warenwirtschaft, die unser existenzielles Resonanzbedürfnis, das heißt, unser „Beziehungsbegehren in ein Objektbegehren übersetzt“ (S. 45). Hier setzt Rosa an der Frankfurter Schule an, ohne diese zu zitieren. Und er kommt am Ende des Bandes nochmals darauf zurück, wenn er der völligen Verfügbarkeit der Warenwelt eine gelingende Weltbeziehung als ein „Antwortverhältnis“ (S. 120) entgegensetzt. Das könne der Konsumkapitalismus nicht befriedigen: „Die begehrten Eigenschaften – das selbstwirksame Sich-anrufen-und-verwandeln-Lassen – werden den Objekten bzw. den Waren (zu denen auch die Kreuzfahrt, die Ayurveda-Kur oder die Wüstensafari gehören) selbst zugeschrieben.“ (S. 121) Doch Erlebnisse lassen sich nicht inszenieren, so Rosa. Der „magische Zaubertrick des Kapitalismus“ (ebd.) bestehe nun darin, aus diesen permanenten Enttäuschungserlebnissen das Begehren immer anderer Objekte zu generieren – „ohne in diesen jemals zu finden, was wir suchen“ (ebd.). Die Folge dieses Steigerungs- und Expansionszwangs sei die Zerstörung der Welt, oder – in den Worten Rosas – „die Rückkehr des Unverfügbaren als Monster“ (S. 124).
Rosa greift Topoi wie die „Versäumnisangst des modernen Menschen“ (Marianne Gronemeyer), des „Steigerungsspiels“ (Gerhard Schulze) oder der frühen Konsumkritik (Erich Fromm) auf, ohne sich explizit auf diese zu beziehen. Er setzt den modernen Steigerungs- und Verfügbarkeitszwang in den Kontext von Resonanz, die dadurch verloren gehe. Wenn andere die ökonomischen Wachstumstreiber des Konsumkapitalismus betonen, etwa die Angst vor Deflation, verweist Rosa auf die psychischen Ingredienzien, die den Steigerungszwang am Laufen halten. Folgerichtig warnt der Autor vor den ökologischen Friktionen dieser Entwicklung. Was er uns freilich vorenthält, sind die zivilisatorischen Errungenschaften dieser Moderne, die es durchaus zu retten gäbe, wie etwa Harald Welzer mit seinem Plädoyer für eine „reduktive Moderne“ urgiert.