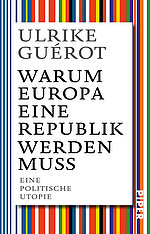Einen völlig anderen Blick auf Europa wirft der niederländische Historiker Kiran Klaus Patel, der eine umfangreiche „kritische Geschichte“ Europas (eigentlich der Europäischen Gemeinschaft) von der Montanunion bis zum Vertrag von Maastricht liefert. Das umfassend recherchierte Buch mit Liebe zu historischen Details zeigt vor allem eins: dass viele Mythen, die sich um Europa ranken (und auf die auch Ulrike Guérot in ihrer Utopie mehrfach zurückgreift) tatsächlich Mythen sind und keine historischen Fakten. Weder sei die europäische Integration der ausschlaggebende Faktor für die Stabilisierung des Friedens gewesen, noch sei die EG allein verantwortlich für den wirtschaftlichen Aufstieg Westeuropas – und vor allem sei Integration nie eine Einbahnstraße nach vorne gewesen, so Patel. Vielmehr gab es im Integrationsprozess immer Rückschläge – Krisen sind, historisch betrachtet, daher eher der Normal- als der Ausnahmezustand in Europa. Patel schließt daraus, dass es nicht die aktuellen Krisen sind, die Europa gefährden, sondern „dass das überzogene Selbstbild der EU das heutige Krisenempfinden verschärft, weil für neu und bedrohlich gehalten wird, was es in ähnlicher Form schon zuvor gegeben hat“ (S. 9). Der Unterschied zu damals: „Die Tatsache, dass die EU heute das allentscheidende Forum für so viele wichtige Politikbereiche auf europäischer Ebene bildet, macht sie anfällig für eine Fundamentalkrise. Probleme können jetzt leichter von einem Bereich auf den nächsten überspringen, da sie in ein und derselben Organisation verhandelt werden“ (S. 21).
Die Geschichte der europäischen Integration wird von Patel als eine der unintendierten Konsequenzen, der Umorientierungen und enttäuschten Hoffnungen erklärt, deren Weg in die heutige Europäische Union keinesfalls klar war. Dies wird anhand verschiedener Politikfelder nachgezeichnet.
Was die Rolle der europäischen Integration für die Stabilisierung des Friedens anbelangt, zeigt der Autor, dass gerade in den volatilen Nachkriegsjahren die Montanunion und ab 1957 die Europäische Gemeinschaft wenig dazu beitrug bzw. nur eine von vielen Organisationen war – noch dazu eine, die nur sechs Mitgliedstaaten hatte. Es waren andere internationale Organisationen, etwa der Europarat, die OECD sowie die NATO, die Westeuropa erstmals unter einem organisatorischen Dach vereinten und sich um politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau kümmerten. Gleichzeitig betont Patel, dass die Montanunion und EG die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland gefördert haben, freilich auch im Kontext des Kalten Krieges: „Der deutsch-französische Gelehrte Alfred Grosser hat einmal ironisch bemerkt, dass eigentlich Josef Stalin den ersten Karls-Preis der Stadt Aachen verdient hätte: Ohne gemeinsame Angst hätte es keine Gemeinschaft gegeben“ (S. 30).
Rückschläge beim Bau der Europäischen Union
Erste Rückschläge beim Bau der Gemeinschaft gab es bereits in den 50er- und 60er-Jahren, mit dem Scheitern einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, einer politischen Gemeinschaft und nach de Gaulles Politik des leeren Stuhls, welche in Folge die Supranationalität in „Europa“ zugunsten der Mitgliedstaaten zurechtstutzte. Trotzdem ging die Integration voran, mit beachtlichen Ergebnissen: Die Etablierung des Europarechts über nationalem Recht mit dem angesehenen Europäischen Gerichtshof und die Stärkung des Europäischen Parlaments in den 60er- und 70er-Jahre waren eine wichtige Integrationsleistung, ohne dass Europa dadurch supranational geworden wäre.
Interessant ist, dass Patel – im Gegensatz zu vielen anderen Stimmen, etwa jener Guérots – einen gewichtigen Beitrag der Europäischen Gemeinschaft sieht, wenn es um die Schaffung von sozialem Frieden geht. Freilich war (und ist) die redistributive Sozialpolitik eine Domäne der Mitgliedstaaten, die diese aus machtpolitischem Kalkül nie aus der Hand geben wollten. Gleichzeitig trug besonders die vielgescholtene Gemeinsame Agrarpolitik zum sozialen Ausgleich bei, indem der Strukturwandel westeuropäischer Gesellschaften mit abfedernden Maßnahmen begleitet wurde und damit wohl heftige Konflikte verhindert wurden. (vgl. S. 87) Auch die forcierte Angleichung von Standards durch die wirtschaftliche Integration zog eine zunehmende Angleichung von sozialen Standards mit sich – eine Entwicklung, die aber spätestens mit der Osterweiterung unterbrochen wurde.
Zum europäischen Wirtschaftswachstum
Was das Wirtschaftswachstum in Europa betrifft, so hatte die EG zweifelsohne ihren Anteil, der jedoch im Kontext eines weltweiten Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen werden muss. Ab den 70er-Jahren setzte man sich verstärkt für den Abbau von Handelshemmnissen ein und forcierte Privatisierungen. Gleichzeitig setzte man auch immer auf starke Regulierung, etwa in der Agrarpolitik. Der vielgescholtene Neoliberalismus war daher immer nur ein wirtschaftspolitischer Ansatz unter mehreren. Ähnlich verhält es sich mit dem Mythos einer erodierenden Unterstützung der europäischen Integration: „Auch vor dem Maastrichter Vertrag von 1992, bis zu dem die EG angeblich durch einen permissiven Konsensus getragen war, erwies sich das Verhältnis der Bürger zu ihrer Gemeinschaft immer wieder als brüchig. Die Zustimmung zum Einigungsprozess ruhte auf einem viel fragileren Fundament, als man bisher angenommen hat“ (S. 151). Zahlreiche Menschen wussten mit der EG, die sie als entfernte Technokratie wahrnahmen, einfach nichts anzufangen. Dies kam nicht von ungefähr, verstand sich diese doch als Elitenprojekt, die Entscheidungen meist ExpertInnen überließ, die intransparent agieren. (vgl. S. 169f.)
Die Unzufriedenheit der BürgerInnen mit dem Projekt Europa blieb lange unbemerkt, weil es keine Möglichkeit gab, in Gemeinschaftsbelangen zu partizipieren (mit Ausnahme der Direktwahlen des Europaparlaments, dem aber lange keine wesentliche Rolle zuerkannt wurde). Erst ab den 1990ern begann man, ein entsprechendes Sensorium zu entwickeln. Die Europaskepsis ist heute groß? Ein historischer Normalfall, wenn man Patel folgt.
Die Europäische Union als "bürokratisches Monster"
Aufgeräumt wird auch mit dem klassischen Vorwurf, dass die EG (bzw. heute die EU) ein „bürokratisches Monster“ sei. Tatsächlich ist die Brüsseler Bürokratie eher klein, aber schlagkräftig – und die Verzahnung mit den Bürokratien der Mitgliedstaaten wurde immer enger, was lange subtil vonstattenging und von den meisten BürgerInnen daher unbemerkt blieb: „Während sich so auf politischer und administrativer Ebene vieles wandelte, schien dies das Alltagsleben der meisten Menschen kaum zu tangieren – die ihrerseits kein großes Interesse an diesen Prozessen zeigten. Und als die Effekte verstärkt wahrgenommen wurden, waren die wesentlichen Grundlagen schon gelegt, so dass ein Zurück schwierig wurde“ (S. 227). Gleichzeitig war durch die „Brüsseler Bürokratie“ der Nationalstaat nie in Bedrängnis, vor allem, da die meisten Verwaltungsakte ja auf die Mitgliedstaaten selbst zurückgingen.
So wie das „bürokratische Monster“ geistert auch das Gespenst der Dysfunktionalität der EG/EU (Stichwort „Butterberge“) durch die Geschichte der europäischen Integration. Immer wieder kam es zu Reformen, die oft nur halbherzig gelangen und auch Schritte zurück beinhalteten: Erneut sei hier die krisengeschüttelte Gemeinsame Agrarpolitik genannt, aber auch die ersten Schritte in Richtung gemeinsame Währung ab den 1970er-Jahren.
Patel beendet seine umfangreiche Publikation mit der Anmerkung, dass alle Integrationsschritte stets als unvollkommen angesehen wurden. (vgl. S. 345) Man kann auch sagen: Nach der Reform ist vor der Reform; Durchwursteln war und ist die angesagte Strategie; und Krise ist immer. Daher: „In vielen Fragen ist die EU ein überraschend junges Konstrukt, in dem Abläufe und Kompetenzen wesentlich weniger erprobt sind, als es die knapp siebzig Jahre seit Gründung der Montanunion vermuten lassen. Das sollte Demut, aber vielleicht auch Nachsicht lehren“ (S. 347). Freilich kann man vieles besser machen, von Transparenz über Partizipation und Kontrolle bis zum Andenken neuer Formen von Integration. Aus der Geschichte zu lernen, wäre ein erster Schritt.