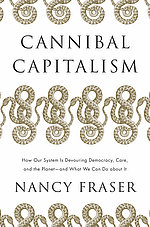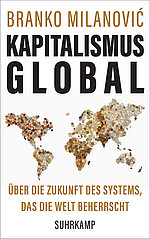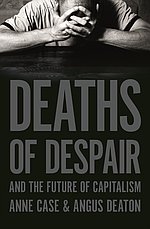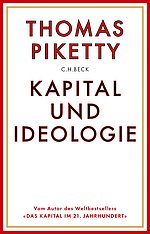„Fachkundig bis ins Detail wie kaum ein anderer Parteienvertreter im Bundestag, mit einer klaren Linie für eine bessere Regulierung der Banken, ideologisch aber nicht verbohrt, wäre er eine Idealbesetzung für das Finanzministerium“, so urteilte Die Welt über den Grünparlamentarier Gerhard Schick im Zusammenhang mit seinem Buch „Machtwirtschaft – nein danke“. In der Tat belegt der „grüne“ Ökonom, Jahrgang 1972, seine zentrale These, dass die gegenwärtige „Machtwirtschaft“ wenig mit Marktwirtschaft zu tun habe, mit einer Fülle an Indizien. Die da wären: Konzentration des Wirtschaftsprozesses auf große multinationale Konzerne, Monopolisierung im Bereich zentraler Dienstleistungen – so sei nicht nur der deutsche Strommarkt, sondern auch jener der Wirtschaftsprüfer weitgehend auf ganze vier Unternehmen beschränkt, die den Markt dominieren –, oder Aufblähung des Finanzmarktes, der auch in Deutschland zum Aufbau von großen „Scheinvermögen“ geführt habe (denn nichts anderes seien Lebensversicherungen, die ihren Wert nicht halten).
Schick kritisiert – wie andere auch – die Netzwerke der Multis, deren Fixierung auf Wachstumszwang und Renditefixierung, die Umverteilung von unten nach oben sowie das Scheitern des Staates als „Wirtschaftsakteur und Planer“. Nicht Wettbewerb, sondern Marktmacht bestimme das Wirtschaftsgeschehen. So hätten die großen Konzerne beispielsweise bedeutend mehr Möglichkeiten, ihre Produkte durch Werbung zu platzieren als die kleinen und mittleren Unternehmen, die in Deutschland 99,6 Prozent der Betriebe und 60 Prozent der Beschäftigten stellen (S. 39). Und die Vermögenskonzentration sei nur möglich gewesen, weil immer mehr Unternehmenserträge bei den Aktionären und nicht bei den Beschäftigten blieben. Letztere sowie der Staat mussten sich verschulden, während die Vermögenden wieder die Schuldtitel kauften. Ein klares Machtungleichgewicht. Die Schlussfolgerung: „Big Business fürchtet deswegen einen funktionierenden Markt genauso wie einen funktionierenden Staat, der Regeln zur Begrenzung wirtschaftlicher Macht setzt.“ (S. 60)
Mit dem mittlerweile verstorbenen Ökonomen Mancur Olsen („Die Logik des kollektiven Handelns“) beschreibt Schick schließlich auch die Einflussnahme der Mächtigeren auf den Staat, welche mittels Kampagnen, aber auch „geräuschlos und wirkungsvoll“ Gesetzesvorhaben in ihrem Sinne beeinflussen. Als Beispiele nennt der Autor die deutsche Mobilindustrie sowie den Bankensektor. Und was Veränderung noch schwieriger macht: Es geht auch um die Privilegien, die Menschen in der Politik aus dieser Verfilzung – Schick spricht von „großartiger Partnerschaft“ – ziehen.
Neue Regeln
Wie könnten und sollten nun ein „funktionierender Markt“ und ein „funktionierender Staat“ im Kapitalismus hergestellt werden? Als erstes nennt Schick, dass wir die Gegenüberstellung von ´links gleich staatsorientiert´ und ´rechts gleich marktorientiert´ rasch vergessen sollten. Denn diese sei falsch und bringe die Linke in eine Defensivposition. Vielmehr müsse aufgezeigt werden, wie und wo „Mutti Staat“ (S. 133) sich für die Mächtigeren einsetzt: durch Subventionen für Großbanken, PPP-Modelle für die Bauwirtschaft zu Lasten der SteuerzahlerInnen oder durch Ungleichbehandlung von Kapital- und Arbeitseinkommen. Viele BürgerInnen würden daher, zitiert der Autor Umfragen, den Staat nicht mehr als den Ihren wahrnehmen, sondern als „Staat der Anderen“ (S. 140).
Ziel in einer Marktwirtschaft muss laut Schick sein, dass „sich die Anbieter an den Bedürfnissen der Nachfrager ausrichten müssen“ (S. 145), was eine dezentrale Steuerung durch Konsumentensouveränität erfordere. Zudem müsse der Staat – im Sinne des Ordoliberalismus – „den Wettbewerb garantieren und dafür sorgen, dass sich niemand zu Lasten anderer bereichern kann“ (S.147).
Schick referiert in der Folge eine Vielzahl „grüner“ Vorschläge zu einer Ökologisierung und Humanisierung des Wirtschaftens. So soll das BIP als Wohlstandsindikator ergänzt werden durch weitere Parameter: den ökologischen Fußabdruck, die Einkommensverteilung sowie die mittels Befragungen zu erhebende Lebenszufriedenheit (S. 155). Und anders als sein Parteifreund Ralf Fücks (s. PZ 2014/2) plädiert Schick dafür, „sich auf eine wachstumsarme Wirtschaft vorzubereiten“ (S. 157). Mit dem kanadischen Ökonomen Peter Victor („Managing without Growth“) sei dies möglich durch eine „Änderung der Investmentstruktur hin zu öffentlichen Gütern, Arbeitszeitverkürzung und eine ökologische Steuerreform“ (S. 158). Notwendig sei auch die Einführung von „Top-Runner-Regelungen“, denen gemäß die ökologischsten Produkte zu einer bestimmten Zeit nach einer festgesetzten Frist zum Standard werden müssen. Zudem hofft Schick auf Vorreiter wie Genossenschaften und Modelle solidarischer Ökonomie: „GLS-Bank statt Deutsche Bank, Linux statt Microsoft, die Schönauer Stromrebellen statt Vattenfall – das sind Vorbilder, wenn wir wegkommen wollen von einer Wirtschaft, die zwar viel Geld produziert, aber an vielen Stellen unseren Wohlstand gefährdet.“ (S. 163)
Kanada gilt dem Autor als Vorbild hinsichtlich Finanzpolitik, da das Land 1998 die Fusion von Banken im Land mit der Gefahr der zu starken Machtkonzentration untersagt hatte und daher „erstaunlich gut durch die Finanzkrise kam“ (S. 170). Größenbremsen für Banken könnten etwa erreicht werden, „indem man die regulatorischen Anforderungen [mit der Größe der Bank] überproportional steigen lässt“ (S. 175). Zudem müsse das Haftungsprinzip für alle Unternehmen ausgeweitet, die Anonymität von Unternehmen (etwa im Hinblick auf Steuerhinterziehung) unterbunden werden.
Schick plädiert zudem für eine Redimensionierung der Finanzmärkte sowie ihrer Komplexität (Übergang zum „boaring banking“) und eine drastische Verringerung der Schulden - etwa durch eine einmalige Vermögensabgabe, wie sie u. a. Daniel Stelter von der Boston Consulting Group in „Die Billionen-Schuldenbombe“ fordert. Im Bundestag seien zwar nach Ausbruch der Finanzkrise viele Gesetze verabschiedet worden („Wir müssten den Preis der fleißigsten Parlamentarier und Parlamentarierinnen bekommen“, S. 184), doch immer mit dem Ziel der Optimierung, während es darum gehen müsse, den Finanzsektor kleiner und langsamer zu machen, resümiert der Abgeordnete.
Abschließend kommt Schick auf das Ausbleiben koordinierter und in der Tat wirksamer Massenproteste nach Ausbruch der Finanzkrise, die eine Sozialisierung der Spekulationsverluste verhindern hätten sollen, zu sprechen. In der lediglich „horizontalen Empörungskultur“ der Nischenproteste etwa von Occupy und der Nicht-Kooperation mit NGOs, Gewerkschaften und Parteien der politischen Linken im „heißen Herbst 2008“ sieht der Autor das Versäumnis, das wirkungsvollen Druck auf die Politik verunmöglicht habe. Außerparlamentarische Opposition müsse mit parlamentarischen Kräften zusammenarbeiten und sich irgendwann auch in anderen parlamentarischen Mehrheiten niederschlagen, denn es brauche die „doppelte Schlagkraft“, so Schick. Letztlich müsse die nur nationalstaatlich ausgerichtete Politik überwunden werden, um die Macht der Konzerne zu zähmen. Dass dies möglich sei, illustriert der Autor am „progressive movement“ Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, dem es gelungen war, die Macht der Trusts zu bändigen und die Verelendung der Massen zu überwinden.
Schicks Analyse ist zutreffend und seine zahlreichen Vorschläge, entwickelt aus engagierter parlamentarischer Tätigkeit, bezeugen die Notwendigkeit eines offenen Parlamentarismus. Die Hürden liegen wohl in Defiziten des öffentlichem Diskurses, der sich in einem sehr kurzatmigen Empörungsjournalismus verliert, sowie in der Schwierigkeit, Menschen, die trotz Finanzkrise noch immer im Konsum „zerstreut“ werden, zu aktivieren und zu organisieren, um sich ihrer eigenen Interessen zu wehren.
Hans Holzinger
Schick, Gerhard: Machtwirtschaft - nein danke. Für eine Wirtschaft, die uns allen dient. Frankfurt: Campus, 2014. 288 S. € 19,99 [D], 20,60 [A], sFr 30,- ISBN 978-3-593-39926-3
„Bei der Bankenrettung in Europa sind nicht nur die Einlagen der Kleinanleger gesichert worden. Nein, auch alle anderen Gläubiger, die man hätte durchaus beteiligen können, wurden gerettet.“ (S. 135)
„Die Wirtschaft wird nicht mehr von unten gesteuert, weil auch der Staat, der die Regeln setzt, nicht mehr von unten gesteuert wird – und umgekehrt.“ (S. 220)
„Das Versprechen der Konsumgesellschaft, dass wir uns über die Gestaltung unserer Gesellschaft keine Gedanken mehr machen müssen, bedroht die Basis der demokratischen Mitbestimmung ebenso wie der zunehmende Blick nur auf sich selbst und seine Interessen.“ (S. 221)
„Genauso wenig, wie der US-Staat Ohio damals die Macht des in seiner Hauptstadt Cleveland niedergelassenen Giganten Standard Oil bändigen konnte, so unmöglich ist es in den heutigen staatlichen Strukturen, Shell, Nestlé oder Vodafone an die Leine zu nehmen.“ (S. 238)