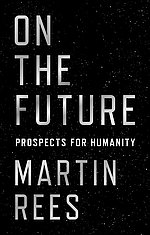Die Zukunftsforschung hat ihre eigene Geschichte. Joachim Radkau hat sich diese für die Zeit nach 1945 in Deutschland genauer angesehen. Was die Leserin und den Leser erwartet: Ein umfangreicher Essay in dem sehr viel Material zu sehr verschiedenen Themen sortiert vorgestellt und kommentiert wird. Das hat den Vorteil, dass man an sehr spannende Wendungen in der Geschichte der Zukunftsforschung erinnert wird, dass Debatten, die heute noch geführt werden, zurückverfolgbar werden und dass etliche Quellen ergänzt werden, die bislang in wichtigen Werken fehlten.
Die Zukunftsforschung hat ihre eigene Geschichte. Joachim Radkau hat sich diese für die Zeit nach 1945 in Deutschland genauer angesehen. Was die Leserin und den Leser erwartet: Ein umfangreicher Essay in dem sehr viel Material zu sehr verschiedenen Themen sortiert vorgestellt und kommentiert wird. Das hat den Vorteil, dass man an sehr spannende Wendungen in der Geschichte der Zukunftsforschung erinnert wird, dass Debatten, die heute noch geführt werden, zurückverfolgbar werden und dass etliche Quellen ergänzt werden, die bislang in wichtigen Werken fehlten.
Das Buch ist flüssig zu lesen, man hört Radkau zu, wie er aus einer Geschichte erzählt, in der er eine relevante Rolle spielte. Radkau (Jahrgang 1943) verfasste zu Beginn der 70er-Jahre ein Standardwerk zum Aufstieg und zur Krise der deutschen Atomwirtschaft, war der Umweltbewegung immer verbunden und erhielt 2012 den Umwelt-Medienpreis der Deutschen Umwelt-Hilfe.Radkaus lange Erzählung über die „Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute“ befasst sich in den ersten Teilen mit Prognosen zum Wiederaufbau und zur Stabilisierung der Ernährungslage nach 1945 und zum kalten Krieg („Die Russen kommen“). Im Ablauf der chronologisch geordneten Themen folgt danach die Auseinandersetzung über die Nutzung der Atomenergie und eine scheinbar drohende „Bildungskatastrophe“. Es geht immer wieder auch um Bemühungen, vor allem ab Mitte der 1960er-Jahre, die Zukunftsforschung zu institutionalisieren. Ausreichend Platz nehmen die Debatten über Utopien (geführt gerne mit Ernst Bloch) und möglichst exakte Pläne über den Verlauf der näheren Zukunft ein (man denke an die Wirtschaftspläne der deutschen Regierung der 1970er-Jahre). Der Gegenwart nähert sich Radkau mit der Darstellung der Debatten über das deutsche Krisenempfinden der Jahrtausendwende, den Nachhaltigkeitsdiskurs sowie über Arbeit 4.0 an. Besonders interessant sind die Kapitel über den Zukunftsdiskurs in der DDR, weil dieser bislang weit weniger reflektiert ist als jener in Westdeutschland.
Es entsteht ein fast durchgehendes Bild des Scheiterns der Vorhersagen. Der Autor geht dabei sehr unterschiedlich streng mit den Autorinnen und Autoren ins Gericht. Am Ende jedenfalls bedeutet der Gesamtbefund für Radkau nicht, dass man die Beschäftigung mit der Zukunft aufzugeben habe. „Eins ist vorweg sicher, nach all den Erfahrungen mit Fehlprognosen: Die perfekte Prognose gibt es nicht.“ (S. 430) Radkau formuliert zehn Thesen am Ende des Buches, die den Kern seiner Erkenntnisse darstellen sollen. Demnach dürfe man die Offenheit großer Fragen nicht leugnen und dürfe keine Zukunftssicherheit vortäuschen. Damit verbunden müsse die Bereitschaft für Diskussion und Selbstüberprüfung – vor allem auch der Prämissen der Vorhersagen – sein. Immer ist die Verwurzelung der Entwürfe in der Gegenwart zu reflektieren und auch das Unerwartete zu (be)denken. Radkau betont die Notwendigkeit, gewünschte und wahrscheinliche Zukünfte nicht zu verwechseln. Erwartete Entwicklungen apokalyptisch zu überzeichnen sei gefährlich, weil es die Bereitschaft auf Botschaften zu hören langfristig reduziere – wenn sich die realen Veränderungen als im Vergleich zur Vorhersage weniger dramatisch herausstellen. Gleichzeitig müsse man in der Rezeption von Zukunftsvoraussagen sowohl Utopien als auch katastrophalen Szenarien Aufmerksamkeit schenken, denn immer wieder war aus ihnen viel zu lernen. Und als Handlungsanleitung bei Gefahrenszenarien schlägt Radkau vor, im Zweifelsfall „auf der sicheren Seite“ zu bleiben.
Robert Jungk spielte in der Geschichte der Zukunftsforschung eine bedeutende Rolle. Radkau anerkennt dies, spricht von Jungk als dem populärsten deutschen Zukunfts-Publizisten, der mit dem Stil der Reportage die Zukunft in der Gegenwart aufzuspüren versuchte. (S. 100) In dieser Beschreibung steckt aber auch die Kritik, die Radkau an Jungk übt. Immer wieder weist der Autor auf Wendungen in Jungks Denken hin, die er mal als „verwirrend“ (S. 101) mal als Verkörperung „des Zickzack der Zukünfte“ (S. 166) beschreibt. In diesen Passagen schwebt ein Anspruch mit, dem Radkau eigentlich selbst eine Abfuhr erteilt: Die Idee, dass Menschen, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, Jahre oder gar Jahrzehnte lang konsistente Aussagen treffen sollen. Gerade im Falle Jungks ist aber die Gebundenheit seiner Zukunftsaussagen ganz offensichtlich in der jeweiligen Zeit zu sehen, in den Diskursen, in denen er sich bewegte, den Erfahrungen die er machte. Die Wendungen sind schön dokumentierbar, da Jungk sich nach der Veröffentlichung umfangreicher Texte nicht jahrelang zurückzog, sondern permanent publizierte, um – so sein Anspruch – in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Jungk reflektierte dies übrigens auch: Sowohl seine Einstellung zur Atomenergie als auch zur Zukunftsforschung änderte sich im Lauf seines Lebens und immer wieder schreibt er selbst über sein Verwerfen alter Ideen und das Aufgreifen neuer Überlegungen.
Radkaus Buch ist lesenswert, es ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Zukunftsforschung und seine abschließenden Thesen passen auch zum Kanon der heute sehr zurückhaltenden und selbstkritischen akademischen Zukunftsforschung. Stefan Wally
Radkau, Joachim: Die Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute. München: Hanser, 2016. 544 S., € 28,- [D], 28,80 [A] ; ISBN 978-3-446-25463-3